Die Schriftstellerin Michal Pitowsky veröffentlichte bisher drei Romane: „Asphalt“ (Keter, 2012), „Die Kommune“ (Uganda, 2017) und „Dinge, die im Nirgends geschehen“ (Yediot, 2019). Sie leitet Schriftsteller-Workshops und doziert über ihre Bücher in Mittelschulen. Zuvor war sie DJane. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Giwatajim.
Die Kommune ist ihr zweiter Roman, eine politische Satire, die in der Gegenwart spielt, in einer Kommune von 18-jährigen Volontären. Der folgende Auszug ist die Geburt der Idee, die im Verlauf des Romans zur zentralen Handlung wird. Die Urheberin der Idee ist Inzi. Der Kosename Inzi (z wie Ziel und Zeit) wurde ihr gegeben, weil sie so viel weiß; auf Hebräisch nennt man so jemanden eine „wandernde Enzyklopädie“.

Die Kommune
von Michal Pitowsky
Übersetzung: Uri Shani
… In der Wohnzimmerecke, fast im Dunkeln, saß Inzi. Sie saß im Schneidersitz im Sessel, den sie liebte, ein zerschlissenes Möbel von der Art, wie man sie nur in Kommunen der Jugendbewegungen findet, oder in Zeltlagern von Obdachlosen. Ihre Finger spielten mit den Fäden, die sich vom Polster lösten. Sie nahm nicht am Gruppengespräch teil. Wie gesagt, Inzi war nicht von der Sorte Menschen, die verzweifeln, das gab es in ihrem Lexikon gar nicht. Vielleicht waren es ihre Eltern, die sich gegen alle Chancen und Voraussagen hartnäckig darum bemüht hatten, sie am Leben zu erhalten. Vielleicht waren es die Gnade und die Vergebung, die sie in sich mobilisieren musste, um mit all den Banausen und Zynikern auszukommen, denen sie in ihrem Leben begegnet war. Nein, Verzweiflung war, wie es Sara sagte, ein Privileg, und ein solches hatte sie keines in Petach Tikwa gehabt. Nicht genug, dass die Verzweiflung immer in eine Sackgasse führte, sie konnte auch fatal sein, wenn sie sich des Bewusstseins bemächtigte. „Genossen, Genossen“, sagte sie aufgeregt und schob ihre Brille zurecht, und merkwürdigerweise verstummten alle immer, wenn sie etwas zu sagen hatte (oder sie wusste genau, wann der richtige Moment war, gerade wenn das Gespräch einen Tiefpunkt erreicht hatte).
„Genossen, Genossen, ihr habt alle recht. Was soll ich schon sagen. Genau so: Ihr habt alle recht. Aber: Es ist euch allen egal. Bald wird nichts von Eurer Rechthaberei übrigbleiben.“
Sie hielt dramatisch inne und gab der Stille die Kraft, sich aufzubauen. Schimri dachte, sie hätte geendet und sagte: „Ja, das wollte ich doch sagen. Der Staat steht in Flammen, und wir beschäftigen uns mit Blödsinn. Wir müssen demonstrieren, in Bil’in, in Scheich Dscharrah. Wir müssen klarer sein in unserer politischen Zielsetzung.“
Die jungen Genossen bedeuteten ihm, er solle schweigen, denn sie sahen, dass Inzi nicht geendet hatte. Schimri zog sich zurück und verstummte.
„Ich möchte euch etwas fragen. Schämt ihr euch dafür, dass ihr Linke seid?“ fragte Inzi.
Es herrschte eine peinliche Stille, und die Genossen lugten aufeinander, als würden sie gleich in lautes Gelächter ausbrechen.
„Ich ziele auf etwas hin mit meiner Frage, und deshalb möchte ich, dass ihr sie einen Moment lang ernst nehmt.“
„Was hast du gefragt? Ich bin nicht sicher, dass ich richtig gehört habe“, fragte Liwnat.
„Ich habe gefragt, ob ihr euch dafür schämt, Linke zu sein. Ob ihr, wie ich es tue, während eurer Aktivitäten nicht all zu stark auf das Politische pocht. Ob ihr, wie ich, nicht darüber sprecht, wenn ihr versucht, neue Mitglieder für die Bewegung zu rekrutieren, ob ihr, wie ich, Beleidigungen wie „dreckige Linke“ auf dem Pausenplatz in der Schule ignoriert, und hofft, dass derselbe trotzdem zur Bewegung kommen wird.“
„Du weißt genau, dass wir ausgespielt haben, wenn wir die Politik mit hineinnehmen, während wir neue Mitglieder rekrutieren“, sagte Liwnat.
„Ja, was machen wir denn hier überhaupt?“ mischte sich Schimri ein, „Inzi hat recht. Warum schämen wir uns? Müssen wir verstecken, woran wir glauben?“
„Die Frage ist, ob es klug ist, unsere politische Überzeugung ins Zentrum zu stellen“, sagte Liwnat, „oder besser die pädagogische Arbeit. Vielleicht sind wir bereit, einen Kompromiss zu machen, damit auch Rechte zur Bewegung kommen und Gemeinschaft, Gleichheit und Zusammenarbeit erleben. Das drückt ja schlussendlich auch unsere Werte aus, nur nicht so direkt.“
„Ferienlager, das ist es“, spuckte Schimri verächtlich aus.
„Ja, auch ein bisschen Spaß. Was soll’s? Ist das etwa verboten? Muss denn alles Politik sein?“
„Weißt du, wenn ich einen zehnjährigen Jungen höre, der sagt: ‚Die Araber in die Gaskammern‘, dann vergeht mir die Lust, Spaß mit ihm zu haben.“
„Wer hat das gesagt?“
„Was solls? Awiad hat das gesagt, aber wirklich, das könnte doch jeder von denen sein.“
„Awiad ist in der siebten Klasse“, verbesserte ihn Liwnat, zu Schimris Erstaunen, „und du hast gesagt ein Zehnjähriger.“
Wie im Fall der Diskussion über die Geschlechtergleichheit in den zu belegenden Posten in der Kommune, verzettelte sich auch jetzt wieder das Gespräch in kleine Subgespräche, die diejenigen Jugendlichen miteinander führten, die nebeneinander saßen. Ja, sie kannten diese Worte: „Verräter“, „dreckige Linke“, „Schwein“, „in die Gaskammer mit dir“, „deine Mutter soll in Gaza vergewaltigt werden“, und so weiter. Während den Demonstrationen, insbesondere denen, die für eine politische Lösung des Palästinenserproblems einstanden, hatten sie schon jeden möglichen Fluch gehört. Die meisten gingen nicht an die Demonstrationen, und auch die Jüngeren wurden nicht dazu aufgerufen. Ganz allgemein herrschte eine Stimmung, dass es nicht pässlich sei, laut seine Ansichten auszusprechen, nur neben jemandem, von dem man weiß, dass er mit dir einverstanden ist. Sonst entsteht eine unangenehme Situation, ein lauter Streit, und danach bleibt man zurück mit einem Gefühl, dass das alles zwecklos gewesen war.
„Genossen, wie ich vorhin gesagt habe“, sagte Inzi wieder, und alle verstummten. „Dieses ganze Symposium ist irrelevant. Es bringt uns nirgends hin.“
„Du hast ja damit angefangen“, murmelte jemand.
„Stimmt, ich habe damit angefangen. Ich habe damit angefangen, denn ich hatte eine Pointe. Alle diese Dinge geschehen uns nicht von ungefähr. Es ist kein Zufall, dass wir es nicht schaffen, neue junge Mitglieder zur Bewegung zu rekrutieren, es ist kein Zufall, dass so kleine Kinder solch schreckliche Dinge sagen, so schrecklich, dass wir es nicht einmal wagen, unsere Aktivitäten mit politischen Inhalten zu verbinden. Es ist kein Zufall, dass wir eine Minderheit sind, eine immer kleiner werdende Minderheit, und während wir um den heißen Brei herum reden, mit Blick auf unseren Bauchnabel, und uns fragen, ob wir genügend feministisch sind, und genug gegen die Besatzung, und genug ausgeprägt oder nicht genug ausgeprägt, währenddessen schrumpfen wir zu einer lächerlichen Sekte. Und dann, wenn wir endlich laut unsere Ansichten aussprechen, werden wir angekuckt, als seien wir verrückt. Ich sage euch, ganz persönlich, ich kam mit den besten Vorsätzen zu diesem Dienstjahr. Ich sagte mir, die Jugendbewegung, das ist das Instrument, um die Situation zu verändern. Man kann Jugendliche rekrutieren, man kann sie überzeugen, wenn sie noch klein sind, wenn ihre Ansichten noch nicht ausgereift sind, man kann die öffentliche Stimmung beeinflussen. Aber das stimmt nicht. Die meisten Menschen, in neunzig Prozent der Fälle, haben dieselben Ansichten wie ihre Eltern, und wenn wir versuchen, das zu ändern, dann spülen wir unsere Ressourcen in die Kanalisation.“
„Was sagst du also eigentlich? Wir sollen das alles lassen? Aufgeben? Was sollen wir mit so einer Einstellung machen?“ fragte Zoya erzürnt. Zoya war eine gute Freundin von Inzi aus der Gruppe in Petach Tikwa, und sie kannte Inzis Stil und ihre Reden.
„Okay, ich habe eine Idee“, sagte Inzi, und nachdem sie bis jetzt in einem kalten und sachlichen Ton gesprochen hatte, fast wie ein Roboter, verschlug sich jetzt ihre Stimme, und ihre Wangen röteten sich. „Aber es wird sich zunächst völlig verrückt anhören. Ich habe darüber ein paar Tage lang nachgedacht, sogar Wochen, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verstehe ich, dass dies die einzige Lösung ist. Was sagt ihr dazu, dass wir selber Kinder machen? Lacht nicht, das heißt, ihr könnt lachen, aber ich meine es ernst. Wir sind zweiundzwanzig junge Menschen. Wenn wir jetzt beginnen, können wir eine Menge Kinder machen.“
Die Kommunarden schauten einander an, Inzis Worte schwebten über ihnen. Schimri war der erste, der loslachte, dann kamen die anderen dazu. Nur Zoya starrte Inzi besorgt an. „Habt ihr gehört, wie dramatisch sie das gesagt hat, also ‚He, Kumpels, jetzt is aber Schluss mit spielen. Wir müssen Kinder machen'“, witzelte Schimri.
„Ok, ich verstehe, dass ihr das lächerlich findet“, fuhr Inzi fort, vom Gelächter unbeirrt. „Das ist keine Idee, die man einfach so akzeptieren kann. Es tönt absurd. Aber wenn ihr ein wenig nachdenkt, alle machen das hier. Die Ultra-Orthodoxen, die Siedler, die Araber. Es gibt sogar diese russische Knesset-Abgeordnete, die acht Kinder gemacht hat, damit sie alle Kämpfer im Militär werden. Sie ist nicht religiös. Sie hat es aus rein politischen Gründen gemacht.“
„Sie ist nicht mehr in der Knesset“, verbesserte sie Schimri.
„Aber ihre Kinder gibt es noch. Sie wurden geboren. Das ist eine Tatsache. Versteht ihr? Versteht ihr, was das für eine Kraft ist? Alle politischen Bewegungen im Staat benutzen das demographische Mittel, nur die Linke nicht.“
„Dieses demographische Mittel, das ist unsere Gebärmutter“, sagte Zoya scharf. Sie verstand, mehr als die anderen, Inzis Autorität und Einwirkung. Sie verstand, dass ihre Freundin in eine Idee verknallt war, und dass sie fähig war, sie umzusetzen. Inzis Ideen hatten immer etwas Bizarres, und nur schon die Herausforderung zu zeigen, dass sie möglich war, machte sie zu etwas, das man umsetzen musste.
„Zoya, auch der Feminismus ist in der heutigen politischen Atmosphäre in Gefahr auszusterben. Siehst du denn nicht, dass es schon geschieht? Siehst du nicht, dass der feministische Kampf immer schwieriger wird, dass wir immer mehr zurückgedrängt werden? Dass wir jetzt darum kämpfen müssen, um auf Poster zu erscheinen und auf der Bühne sprechen zu dürfen? Feminismus ist eine abgehobene Philosophie, aber sie hat einen Einfluss auf die Geburtenraten. Und es bedeutet, dass immer mehr nicht-feministische Menschen geboren werden, und deshalb hat es der Feminismus so schwer, schon heute. Und das stimmt für alle ideologischen Prinzipien, die mit Menschenrechten, persönlichen Rechten, Humanismus zu tun haben. Denn eine hohe Geburtenrate steht im Gegensatz zu all diesen Werten. Und was bedeutet das? Dass diese Werte essentiell, per definitionem, nicht auf die Länge bestehen können? Dass sie immer innert einer oder zwei Generationen den gegensätzlichen Werten unterliegen werden, nur weil sie nicht mit der Münze zurückzahlen wollen, mit der Geburtenrate? Oder vielleicht sind wir einfach faul und verwöhnt? Vielleicht sind wir einfach nicht bereit, uns im selben Maß aufzuopfern für das, woran wir glauben, und deshalb werden wir immer verlieren?“
Das Zimmer schien zu vibrieren nach Inzis letzten Worten, als hätte es Kopfweh. Vor allem Schimri schrumpfte in sich hinein, dort wo er saß, neben Inzi, als hätte er einen Schlag erhalten. Bei den anderen war nicht klar, ob sie schwiegen, weil sie im Schock waren, oder weil sie schon müde waren und wollten, dass das Gespräch endlich sein Ende finde und sie ins Bett gehen könnten. Die meisten dachten bestimmt, wenn sie jetzt schwiegen, ließe man sie gehen.
„Du hast recht“, sagte Carmit plötzlich, mit einer Mischung von Wut und Freude. „Du hast so recht. Das ist die einzige Lösung.“
„Das passt so zu dir, mit ihr einverstanden zu sein“, sagte Zoya verärgert. „Mit allem, was sie sagt, bist du einverstanden.“
„Das ist gemein“, sagte Carmit beleidigt. „Als hätte ich keine eigene Meinung.“
„Du hast eine, aber du bist beeinflusst.“ Zoya gab nicht nach.
„Äh, Entschuldigung“, errichtete sich Chagai von seinem Sitz. „Wir müssen nicht hier sitzen und Eure Zickeleien mitanhören. Ich bin völlig fertig, ich bin gerade von einer Wanderung zurück, die ich gemacht habe, um den Ausflug von Chanukka vorzubereiten. Ich geh ins Bett.“
„Hörst Du eigentlich, wie du zu uns sprichst, Chagai? Hörst du den aggressiven Ton, den du benutzt?“, fragte Zoya.
Ein Großteil der Kommunarden war schon aufgestanden und streckte sich. Alle wollten ins Bett. Keiner interessierte sich mehr weder für Geburtenraten noch für irgendetwas anderes, das an diesem Abend besprochen wurde. Inzis Idee blieb nur noch als Witz im Zimmer, als die letzten Kommunardinnen, die noch im Wohnzimmer waren, jede ein Kissen unter das Hemd und auf den Bauch drückte und so im Zimmer „schwerschwanger“ umherging. Sie riefen nach Inzi, Inzi versuchte sie mit ihrem Handy zu fotografieren, aber sie stürzten sich auf sie, wollten nicht, dass Inzi sie so fotografiere, und Schreie aus dem zweiten Stockwerk, es sei schon spät und man solle doch um Gottes willen endlich Ruhe geben und ins Bett gehen, machten dem Spiel ein Ende.




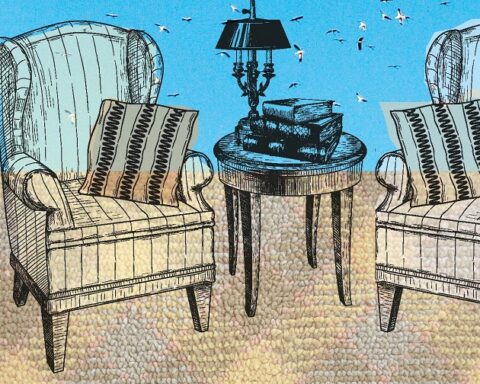






Interessant! Drei kurze Fragen:
1) Yediot und Keter (wo die anderen 2 Romane der Autorin erschienen sind) sind sehr bekannte Verlage. Von „Uganda“ (wo dieser erschienen ist) habe ich noch nie gehoert. Was ist der Hintergrund der Wahl eines unbekannten Verlagshauses fuer diesen Roman?
2) Wer hat das Bild der Titelseite erstellt? Es sieht aus wie die Arbeit eines Kuenstlers.
3) Die Mitglieder der Kommune bezeichnen sich als Genossen (was steht auf Hebraeisch?) – ist das im kommunistischen Sinn zu verstehen?
Die dritte Frage geht an mich, den Übersetzer. Das hebräische Wort „Chawer“ kommt von der Wurzel „ch-b-r“, woraus es zum Beispiel das Verb „lechaber“ gibt: verbinden. Das neuhebräische Chawer hat verschiedene Bedeutungen: Freund, oder Mitglied, oder eben Genosse. Ich hätte auch „Freunde“ oder „Kommunenmitglieder“ übersetzen können, aber ich dachte, für diese Art Gespräch passt Genossen am besten.