2. Teil
Kürzlich musste ich nach einer szenischen Lesung eines Stückes, das ich übersetzt habe, den letzten Bus um Mitternacht nehmen. Auf dem Weg zur Central Bus Station in Tel-Aviv kam ich wieder bei Hanoch Levins Geburtshaus vorbei. Das Quartier „Nawe Sha’anan“ befindet sich zwischen der alten und der neuen Central Bus Station. Als neues Arbeiterquartier vor fast hundert Jahren gebaut, ist es auch heute noch ein Arbeiterquartier, allerdings hat sich die Hautfarbe der Arbeiter geändert. Damals waren es europäische Juden, vorwiegend aus Osteuropa, die dieses Arbeiterquartier bevölkerten. Hanoch Levin, dessen großer Bruder noch in Polen geboren wurde, wuchs in einer armen Familie im polnischen Schtetl auf, in „Nawe Scha’anan“, im Süden von Tel-Aviv. Heute sind die Arbeiter, die dieses Quartier bevölkern, aus Afrika eingewandert. Den jüdische Nationalisten sind sie ein Dorn im Auge. Der Name „Nawe Scha’anan“ (die meisten Israeli sagen fälschlich „Newe Scha’anan“) beinhaltet selber die beiden Hauptkomponenten von Hanoch Levins Werk. In Jesaja 33 nennt der Prophet Jerusalem „Nawe Scha’anan“, also eine ruhige, sichere Oase. Das ist einerseits ironisch, andererseits prophetisch gemeint: Jerusalem war auch damals, vor 2700 Jahren, eine Stadt voller blutiger Kämpfe. Niemand hätte Jerusalem eine ruhige sichere Oase genannt. Das ist einerseits ironisch, da Jerusalem alles andere als eine ruhige sichere Oase war (und ist), und andererseits prophetisch, weil er prophezeit, dass eine Zeit kommen wird, in der das so sein wird. Die Ironie und das Prophetische charakterisieren auch Hanoch Levins Werk, allerdings ist Levins Prophezeiung eine apokalyptische.

Worüber freuen sie sich?
Als junger Mann brach Hanoch Levin aus diesem Armenviertel aus und kam an die Uni Tel-Aviv, was für ihn wie ein anderer Planet von Palästen war. In seinem Buch „Felder und Koffer“ (2014) hat Avraham Oz (einer der wichtigsten Shakespeare-Spezialisten auf der Welt, natürlich gibt es auch über ihn keinen deutschen Wikipedia-Artikel…) ein Kapitel über seinen Freund Hanoch Levin geschrieben. Und so beginnt dieses Kapitel:
„Die Militärbasis El-Arisch im Sinai. Der fünfte Abend von den „Sechs Tagen“, wenn ich mich nicht täusche. Das Licht war flau, denn der Generator war vom israelischen Militär bombardiert und noch nicht wieder instand gebracht worden. Die Luft war voll vom süßlichen Gestank der ägyptischen Leichen, die nicht begraben wurden. Ein Reservesoldat demütigte ägyptische Kriegsgefangenen mit einer Herrschsucht, die mir nicht klar war; aber die Melodie war klar: es war der Beginn der Euphorie. Ich traf auf Hanoch: mein Freund, mit dem ich in der kleinen Fakultät phil II an der Uni Tel-Aviv studierte (wir witzelten darüber, dass man mit der ganzen Bevölkerung der Fakultät kaum zwei partys schmeißen könnte). Beide waren wir Redaktionsmitglieder im „Stachelschwein“, der Studentenzeitschrift der Uni: Ich als Redakteur der Literatursparte, und er schrieb eifrig das „Blatt des Hintern“ (das schon einen Eklat und einen Parlamentsdisput verursacht hatte, als er sich anlässlich des Besuchs von Marlene Dietrich über Prominente lustig gemacht hatte, die sich drängelten, um in die Nähe von „Frau Ilse Koch“ zu kommen). Einige Monate hatten wir vergebens versucht, mit unserm Freund Itzchak Hiskiyah eine Studententheatergruppe zu gründen. Levin gehörte zu einem anderen Regiment als ich, und wir beide standen jetzt hier der allgemeinen Siegesfeier gegenüber. Die ägyptischen Gefangenen und der herrschsüchtige Reservesoldat nicht weit von uns. ‚Worüber freuen sie sich?‘ Ich kann mich an den Ton erinnern, wie er diese Frage stellte. […] Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung von einigen der Leser von Levin, hat der Verfasser der späteren mythologischen Stücke niemals seinen unaufhörlichen Dialog mit der politischen Realität unterbrochen, auf die sein Werk aufbaute, vielleicht seit der antwortlosen Frage an jenem finsteren Abend, der Geburtsstunde der gewissenlähmenden Euphorie: ‚Worüber freuen sie sich?'“
Avi hat mir erlaubt, diese Stelle zu übersetzen und zu verwenden. Der letzte Satz des Zitates steht ein paar Seiten weiter. Worauf darin angespielt ist, ist eine Meinung, die Avi und ich nicht teilen, dass Levin anfangs Siebziger Jahre begonnen hat, Komödien und später mythologische Tragödien zu schreien, die nicht mehr die israelische politische Realität angreifen, damit er besser beim Publikum ankomme.

Und so erzählt Ezra Dagan im Gespräch mit mir, wie es dazu kam, dass Hanoch Levins Satire zum ersten Mal auf die Bühne kam:
E: Ich war Schauspieler in der Theatergruppe der Artillerie. Die Regisseurin Miri Magnus schickte mich zu Hanoch Levin, damals Student an der Uni Tel-Aviv, der dort in der Unizeitung schrieb. Die ersten Sachen, die ich von ihm erhielt, waren lustige Szenen ohne Worte. Dann kam der Krieg von 1967. Dort haben wir ihn bei der Artillerie getroffen, in der Wüste. Und die erste Satire mit Worten, die wir dann nach dem Krieg aufgeführt haben, war über einen Radiojournalisten, der einen Panzersoldaten sucht, um ihn zu interviewen. Er findet aber nur einen ägyptischen. Den habe ich gespielt. Das war lustig, aber der ägyptische Soldat war keine Karikatur, der hatte eine Mutter, die auf ihn wartet. Diese Satire, „Kanone im Kopf“, ist übrigens verlorengegangen. Auch ich habe den Text nicht mehr.
U: Und danach hast du mehrere Male in seinen Stücken gespielt. Erzähle uns davon, bitte.
E: Ich habe in einigen Stücken mitgespielt, die viel Furore machten. Ich habe im „Patriot“ mitgemacht, das zensiert wurde (siehe erster Teil dieser Reportage), und in „Mord“. Am Tag der Premiere von „Mord“ war der Terroranschlag im Markt „Machane Jehuda“. Sie wollten die Premiere verschieben, aber ich – ich hatte ja schon im „Patriot“ mitgemacht, mit der Zensur und den Prozessen und all dem – ich sagte: Nein, wir müssen das machen. Gerade jetzt! Unser Stück sagt ja nein zum Mord! Das müssen wir machen. Und wir haben es gemacht.
U: Sind Levins Texte anders für einen israelischen Schauspieler als andere Texte?
E: Wir lieben die Texte von Hanoch Levin. Wir sind ihnen sehr verpflichtet. Wir ändern kein Wort. Das ist wie Lyrik. Kein Wort, kein Komma, keinen Punkt. Ein Punkt ist ja ein Atemzug. Du änderst nichts. Er schreibt großartig. Er schreibt für die Schauspieler, und du spürst sofort die Figur, die du spielen sollst. Das ist etwas anderes als alles andere. Ich habe auch Nissim Aloni gespielt, aber Hanoch Levin ist eine andere Liga.

Ilan Ronen ist ein sehr bekannter Theaterregisseur in Israel. Auch seine Tochter Yael Ronen ist Theaterregisseurin und lebt und arbeitet in Berlin. Während vieler Jahre haben Ronen und Levin immer wieder mal zusammengearbeitet. Ich sprach auch mit ihm.
I: Meine erste Begegnung mit Hanoch war, als ich das Chan-Theater in Jerusalem leitete. Später war ich der Intendant des Kameri-Theaters, und Hanoch hat damals schon alle seine Stücke selber inszeniert. Aber als ich wieder unabhängig selber inszenierte, machte ich „Hefetz“ von Hanoch Levin, mit Ya’akov Cohen. Die Besetzung von Ya’akov Cohen, einem marokkanischen Schauspieler, dem man seine Herkunft auch anmerkt, als Hefetz, war damals ziemlich gewagt, denn zu dieser Zeit war die Kluft zwischen den Aschkenasim und den Misrachim noch ein Thema, das nicht so häufig auf die Theaterbühne kam. Hanoch war ein sehr bescheidener, angenehmer und freundlicher Mensch. Vor der ersten Lesung lud er mich zu sich nach Hause ein, und ich aß, was er mir aus dem Kühlschrank brachte. Er wusste, dass ich angespannt war, und er wollte mich beruhigen. Nach der Lesung hatte ich Kopfschmerzen, die ich niemals im Leben vergessen werde.
U: Obwohl du als Regisseur bei der ersten Lesung ja eigentlich nichts machst.
I: Ja, natürlich. Aber der Druck seiner Gegenwart war riesig. Und als er dann nach ein paar Wochen wiederkam und sich eine Probe anschaute, erfroren alle zu Eis. In der Pause fragte mich Hanoch: ‚Soll ich gehen?‘ Und ich sagte ihm: ‚Ja, du siehst ja, sie können nicht spielen.‘ Also ging er. Und dabei waren das fast allesamt Kaliber, die mit Hanoch gearbeitet hatten.
U: Vor lauter Ehrfurcht?
I: Ja, Ehrfurcht ist gar kein Wort dafür. Auch ich habe lange Jahre gebraucht, um mich von seiner Übermacht zu befreien. Und dabei hat er ja gar nichts getan. Und er war wirklich ein sehr angenehmer Mensch. Erst jetzt, vor zwei Jahren, als ich ‚Krum‘ inszeniert habe, habe ich mich von seinem Schatten befreit, und das Stück so inszeniert, wie ich es wollte, nicht wie es vielleicht Hanoch gewollt hätte.
Ende des zweiten Teils. Wer den ersten Teil nachlesen möchte, bitte auf diesen Link klicken.
Hannoch Levin Reihe:
Teil 1
Teil 2
Teil 3
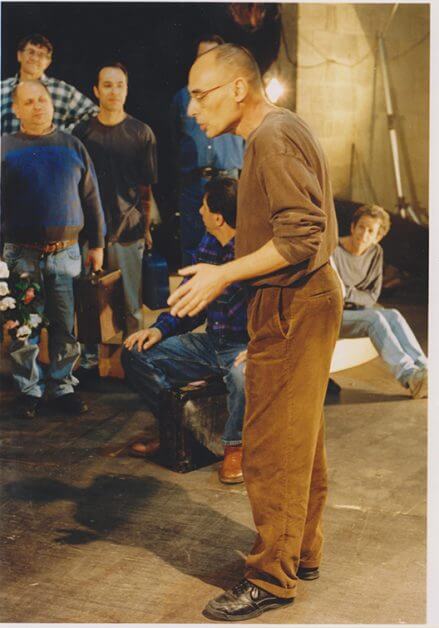
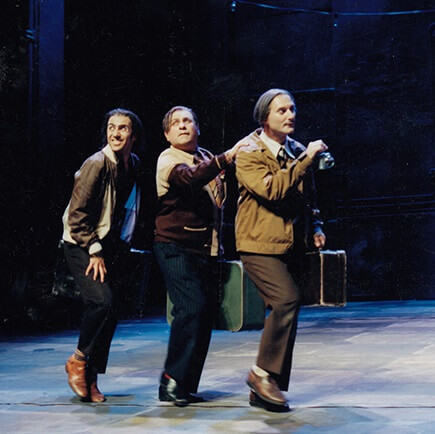


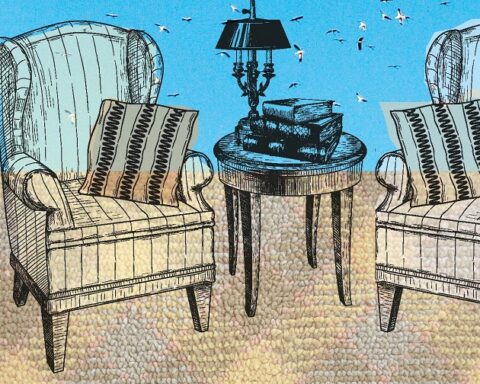






[…] Ende des ersten Teils. Hier der Link zum zweiten Teil. […]
zum einen erschreckt mich der begriff „jüdische nationalisten“ immer, wenn ich ihn lese. ist es wirklich so, dass auch ganze gesellschaftsteile reagieren können wir ein kind, das man von klein auf geschlagen hat und dann selbst zum schlagenden wird? ich muss aber auch gestehen, ich habe keine ahnung von der jüdischen oder der israelischen gesellschaft. mein „eis am stil“-horizont benötigt erweiterung. klar steht tel aviv hoch oben auf meiner liste der wunschdestinationen, bisher aber eher wegen der bauhaus-architektur, die nun scheinbar vor dem endgültigen verfall gerettet wurde oder werden soll.
zum andern bekomme ich von hanoch levin, um den es ja eigentlich geht, kein klares bild, er erschliesst sich mir einfach noch nicht. vielleicht komm ich dazu, mich mehr über ihn einzulesen. was ich immer skeptisch betrachte, sind diese vergötterungen. kein wort wird geändert, kein beistrich, kein punkt. damit kann ich nichts anfangen. bezeichnend deshalb auch, dass sich ilan ronen nach dem tod levins von ihm „befreien“ musste, um platz für die eigene inszenierung zu schaffen. kann es also sein, dass menschen so, wie sie immer den populisten an den lippen hängen, auch den „guten“ völlig unkritisch nachlaufen? kein wirklich schöner gedanke, diese geistige selbstaufgabe. aber was weiss schon ein aussenstehender.
Natürlich ist Vergötterung an sich schlecht. Hanoch Levin wäre der Erste gewesen, der sich dagegen wehrt. Ich selber habe als Regisseur immer frei mit den Texten gearbeitet, allerdings muss klar sein, dass man einen Text zuerst verstehen muss, bevor man es sich erlaubt, ihn zu ändern. Viele Regisseure ändern Texte, weil sie sie einfach nicht verstehen. Und das geschieht auch im „normalen“ Leben die ganze Zeit. Deshalb sage ich: Zuerst zuhören, verstehen, dann kannst Du interpretieren und ändern.
[…] Levin Reihe:Teil 1Teil 2Teil […]