Der Roman „Ramallah-Tel-Aviv“ von Yossi Yona erschien 2015 im HaKibbuz HaMeuchad-Verlag unter dem Titel, der wörtlich übersetzt heißt: „Keine gute Zeit für Liebe“. In seinem Zentrum stehen vier Hauptfiguren, die zu zwei verschiedenen Kulturkreisen gehören. Hadil ist Psychologin, Hisham unterrichtet Literatur. Sie haben zwei Kinder, leben in Ramallah und ihre Ehe steht offenbar kurz vor dem Zusammenbruch. Yoav und Tali leben in Tel Aviv und planen ihr Doktorat in den Vereinigten Staaten, was ihre Beziehung einer schweren Prüfung unterzieht. Die konkrete politische Realität beeinflusst und beeinträchtigt als höhere Gewalt die Wünsche und Pläne dieser vier Hauptfiguren.
Yossi Yona ist 1953 im Durchgangslager von Kiryat Ata geboren. Seine Eltern kamen nach Israel aus dem Irak. Er ist Philosophieprofessor an der Universität Beer-Shewa und ehemaliges Parlamentsmitglied (2015-2019, Avoda). Seine unzähligen Sachbücher und Artikel befassen sich mit den Grenzgebieten zwischen Philosophie, Soziologie, Kunst und Kultur. Sein zweiter Roman ist im Jahr 2020 erschienen. Im Parlament beschäftigte er sich vor allem mit der öffentlichen Erziehung und verschiedenen Aspekten der Wohlfahrt und der sozialen Dienste.

Ramallah – Tel-Aviv
von Yossi Yonah
Übersetzung: Uri Shani
Die Winde wehen nicht immer so, wie die Schiffe es wünschen (arabisches Sprichwort)
Hadil
Sie wartete auf das Taxi, das sie von Ramallah zur Allenby-Brücke bringen sollte, wollte schon außerhalb des Hauses sein. In den frühen Morgenstunden dieses Freitags, als sich die ersten Anzeichen des Frühlings 2007 bemerkbar machten, sollte sie für die Arbeit in eines der Hotels auf der jordanischen Seite des Toten Meeres fahren. Am nächsten Tag, nachdem sie die Arbeit dort beendet haben würde, wollte sie bei ihrer Freundin Aridsch in Amman übernachten. Hischam nippte an seinem schwarzen Kaffee und schwieg, entfernt und verärgert. Ihre Kinder, Laila und Nadim, die sich darauf vorbereiteten, mit ihrem Vater zur Schule zu fahren, empfanden die dicke Luft zwischen den Eltern und nahmen ihr Frühstück ein, ohne viel zu sprechen. Hadil legte wieder ihre Hand auf Nadims Stirn, ein bisschen streichelnd und ein bisschen prüfend, sich vergewissern wollend, dass das Fieber, von dem er nachts gelitten hatte und das am Morgen verschwunden war, tatsächlich nicht wieder gestiegen war.
Nach kurzer Zeit ertönte ein Hupen von der Straße. Ein gehemmtes, zögerndes Hupen, wie um nicht zu stören. So pflegte Amer, der Taxifahrer, sein Kommen anzukündigen. Sie sprang von ihrem Stuhl, froh, sich aus der dicken Luft, die auf der Essecke lastete, hinauszwängen zu können, beeilte sich, ihrer Tochter Leila einen Abschiedskuss zu geben und sah sich nach Nadim um. Sie verstand schnell, dass ihre Freude vorschnell gewesen war; sie war sich nicht bewusst gewesen, dass Nadim sich gerade eben davongeschlichen und im Klo eingesperrt hatte. Sie stand vor der Tür und rief: „Komm, Liebling, komm verabschiede dich von Mama.“ Aber es war kein Laut von der anderen Seite der Türe zu hören.
„Sag Amer, dass ich gleich komme“, sagte sie Leila und fuhr fort, Nadim zu ersuchen, er solle die Tür öffnen.
„Nein.“
„Mein Leben, mein Geist, meine Seele, öffne die Tür.“
„Nein.“
Wieder und wieder versuchte sie es und gab es schließlich traurig auf. Hischam, der die ganze Zeit still auf seinem Stuhl saß, sah sie vorwurfsvoll an. Sie ging zielbewusst zur Haustür. In einer Hand hielt sie einen schwarzen Koffer, dessen kleine Räder quietschten, in der anderen ihre Tasche. Hischam begleitete sie nicht zum Taxi und reagierte nicht auf ihren Abschiedsgruß. Leila gab sich Mühe, ihr zu helfen, öffnete ihr die Tür und nahm ihr die Tasche ab. Hadil machte sich auf dem Rücksitz des Taxis breit und seufzte leise.
Nachdem das Taxi den Chisme-Checkpoint passiert hatte, wählte Amer eine CD aus der Mappe, die auf dem Beifahrersitz lag, mit Liedern des irakischen Sängers Nazem al-Ghazali. Bevor der irakische Sänger mit seiner Stimme den Raum erfüllte, fragte er sie, ob ihr das genehm sei. Sie überlegte sich, ob sie ihm sagen sollte, dass sie es vorziehe, den Weg in Stille zu verbringen, aber sie zuckte nur mit den Schultern und sagte, es sei ihr gleich. Die CD war von mieser Qualität. Spottbillig hatte er sie gekauft. Aber Amer genoss die warme und streichelnde Stimme des Popstars, der vor mehr als fünf Jahrzehnten schon gestorben war. Sie kannte die Lieder bestens. Nazem al-Ghazali war ihres Mannes beliebtester Sänger. War hier eine ironische Hand am Werk, oder war dieser Gedanke nur ein Zeichen dafür, dass die Menschen eine geheime Bedeutung im Zufall suchen? Es schien, als läse Amer ihre Gedanken. Er lächelte und fragte, ob sie seine Lieder mochte. Sie antwortete mit einem schwachen „Ja“ und fügte hinzu, als flossen die Worte gegen ihren Willen aus ihr heraus, dass seine Lieder Meisterwerke seien. Ein schiefes Lächeln hing ihr an den Lippen. So beschrieb Hischam seine Lieder und seinen Gesang – Meisterwerke.
„Niemand singt heute mehr wie Nazem al-Ghazali, möge Allah sich seiner erbarmen“, sagte Amer entschieden und nickte leicht mit dem Kopf, um seinem Urteil mehr Gewicht zu geben. „Wissen Sie“, fügte er hinzu, „er starb jung. Man sagt, seine Frau habe ihn umgebracht.“
„So sagt man…“, antwortete sie nebensächlich. Es war nicht das erste Mal, dass er seine Gedanken in dieser Sache mit ihr teilte.
Ihre lakonische Antwort stoppte seinen Redefluss nicht. Er sprach weiter über die Theorie, dass die Frau des Sängers ihn ermordet habe. Obschon so viele Jahre vergangen waren, beschäftigte sich die arabische Welt weiterhin mit der Frage. So ist es, wenn Abgötter vorzeitig sterben, ihre Jünger werden ihren Tod immer mit mysteriösen Umständen und dunklen Verschwörungen in Verbindung setzen.
„Wissen Sie“, erzählte er, „sie hörte auf zu singen, nachdem er gestorben war. Verstehen Sie“, grinste er, „zuerst bringt sie ihn um, und dann…“ Er machte eine Pause. „Man sagt, dass seine Frau, eine Jüdin, es aus Eifersucht getan habe. Sie war auch eine berühmte Sängerin im Irak, vielleicht die berühmteste. Ich verstehe das wirklich nicht.“ Er schüttelte seinen Kopf, sich über die unlogische Tat empörend. „Können Sie sich vorstellen“, fuhr er fort, „dass eine Frau ihren Mann umbringt, weil sie auf seinen Erfolg neidisch ist? Aber wer weiß“, fügte er abschließend hinzu, „wie das Sprichwort sagt: Wer ist dein Feind? Dein Partner in der Kunst. Tatsächlich! Nicht wahr?“ Er schaute sie durch den Rückspiegel an und wartete auf ihre Reaktion.
„Das muss nicht so sein“, warf sie ein. „Aber natürlich kann Eifersucht schaden.“ Hischams verärgertes Gesicht erschien vor ihrem inneren Auge. Sie hörte Amer nicht mehr zu, aber dachte über ihn nach. Siehe da, dieser angenehme Mann genießt die Lieder dieses verflossenen Sängers, und sie erfüllen ihn mit Lebenslust. Er genoss sie, ohne sie zu seinem Kulturgut zu machen, das ihn von denen unterscheiden und abheben würde, die nicht verstanden, was gute Musik ist. Sie litt unter dem Gram, den sie bei Hischam in den letzten Jahren bei seiner Beschäftigung mit der arabischen Dichtung und dem arabischen Lied verspürte. In der Vergangenheit konnte sie mit seiner Begeisterung mitziehen, aber seit einiger Zeit verlor sie das Interesse an diesem Thema. Es schien, dass sie auf verschiedenen Bahnen fuhren, in umgekehrter Richtung, und dass sie sich nicht mehr treffen würden. Je mehr er sich im Raum der arabischen Dichtung und Musik einzäunte – mit langen und ermüdenden Monologen darüber, dass die hohe Kunst nicht mehr geschätzt werde, über den Materialismus, der sich der palästinensischen Gesellschaft bemächtigte, und über diese und jene kulturellen Missstände – desto weniger konnte sie die Lieder genießen; sie begannen, den mürrischen Stempel seines Gefühls des Misserfolges zu tragen, und so auch den Stempel ihrer eigenen Frustration. Die Entwicklungen im Bereich der elektronischen Medien vergrößerten die Entfremdung zwischen den beiden. Er schaute sich stundenlang alte Videos von arabischer Musik an, vor allem von den Hünen der irakischen Musik, die alle schon längst tot waren. Sie hatte es nie geschafft zu verstehen, warum ausgerechnet diese Lieder und ihre abgrundtiefe Melancholie sein Herz erobert hatten. Die Tätigkeit schenkte ihm in den letzten Jahren einen Zufluchtsort, eine innere Welt, in die er sich verkroch, verschanzte. Es schien, dass die technologischen Neuerungen, die die Welt in die Zukunft führen sollten, ihm den Weg bahnten, sich mit der Vergangenheit zu verbinden.
Auf ihrem Gesicht ruhte ein nachdenklicher, ein bisschen schmerzhafter Ausdruck. Sie schaute durch die Fenster auf die Berglandschaft. Auf beiden Seiten des Weges von Ramallah ostwärts hinunter ins Jordantal, der während der meisten Monate des Jahres dörrgelb war, hatte sich ein grünlicher Flaum gelegt. Dies waren die wenigen gesegneten Tage dieser armseligen Hügel, dachte sie. Sie kamen wenigstens jedes Jahr. Amer, der ihre düstere Stimmung bemerkte, stellte die Musik ab, und sie fuhren in Stille weiter. Der Wagen fuhr an Beduinenzelten vorbei, die wie zufällig neben der Straße hingeworfen worden waren, gemäß einer Logik, die ein Fremder nicht verstehen konnte. Sie sah eine junge schwarzgekleidete Beduinin, die einen Hirtenstab in der Hand hielt. Sie war nicht mit der Herde der weißen Schafe beschäftigt, die gemütlich das grüne Gras fraßen, das jetzt üppig aus dem felsigen Boden sprieß; ihr Blick war auf die vorbeiflitzenden Wagen gerichtet, als stellte sie sich die fernen Ziele vor, zu denen die Fahrer gelangen wollten, Orte, an die sie nie gelangen wird.
Ihre Beziehung mit Hischam war, zum Guten wie zum Schlechten, mit der Welt der Gedichte und der Lieder verwunden. Die Hoch- und Tiefpunkte ihrer Beziehung vermittelten sich durch Sinnbilder, in Farben und Klängen, aus dieser Welt. Dieses Mal glitten ihre Gedanken wegen der Wüstenlandschaft und der Beduinenzelte zu seinen Geschichten über die Liebesgedichte der frühen arabischen Dichtung. Das Leben in der Wüste, hatte er ihr erklärt, war die Inspiration für diese Dichtung. Er benutzte eine von Um-Kulthums Lieder, um seine Worte zu unterstreichen. Das war damals, in seiner kleinen Wohnung in Bir-Set. Wenige Wochen davor hatten sie zum ersten Mal den Geschmack der leiblichen Liebe gekostet und die Scham ihrer Blöße noch nicht überwunden. Hischam erzählte ihr über „Al-Atlaal“, die Ruinen der Liebe.
„Weißt du, der Dichter dieses Liedes war eigentlich ein Arzt. Man sagte über ihn, sozusagen herablassend, dass er der beste Dichter unter den Ärzten war, und der beste Arzt unter den Dichtern.“
Sie stieß ihn sanft mit dem Ellbogen in die Rippen und protestierte. „Das ist aber unschön, das ist gemein!“
„Das sage nicht ich“, lachte Hischam und weichte von ihrem Ellbogen aus. „Das sind die Kritiker, die sagen das.“ Er zog sie an sich heran und fuhr fort zu erzählen, dass viele Gedichte mit der Beschreibung der Überreste des Beduinenlagers begonnen, wo die Geliebte des Dichters gewohnt hatte. Die Überreste, erklärte er, symbolisieren das Ende der Liebe. Die Geschichte ist zu Ende, wenn die Sippen, zu denen der Dichter und seine Geliebte gehören, die Oase verlassen und weiterwandern – jede Sippe geht ihren eigenen Weg, jede Sippe geht ihrem Schicksal entgegen.“ Und dann zitierte er die letzte Zeile des Liedes von Um-Kulthum: „Und jeder ging seinen Weg / sag nicht, wir hätten das gewollt, sag, das Schicksal wollte es so.“
„So?“ warf sie ein und setzte sich ihm gegenüber, mit Blick in seine Augen. „Willst du damit sagen, dass auch deine Liebe zu mir, die du ständig deklarierst, am Schluss verwelken wird, dass unsere Trennung unvermeidlich ist?“
„Gott behüte, meine Geliebte!“ Er fuhr erschreckt zusammen. „Ich werde dich immer lieben. Du bist die Liebe meines Lebens.“
„Warum begeisterst du dich denn für diese Gedichte?“ Sie kniff ihre Augen zu Schlitzen zusammen, mit einem dünnen Lächeln.
Er schaute sie liebevoll an. „Meine Seele war schon mit der ihren verwoben, noch bevor wir erzeugt wurden.“
„Das ist auch aus dem Lied von Um-Kulthum?“
„Nein“, freute er sich, sie zu beeindrucken. „Das schrieb der Dichter Dschamil al-Usri. Er lebte vor langer Zeit. Er schrieb über „Chub usri“, jungfräuliche Liebe. Man sagt über ihn, er sei ein Schahid der Liebe gewesen, an der Liebe gestorben.“
„Schahid der Liebe?“ Sie riss die Augen auf.
„Ja, genau, ein Märtyrer der Liebe!“
„Ich habe den Eindruck, dass jedenfalls Liebe bei dir etwas mit Ende, mit Tod zu tun hat.“
Er zog seine Brust unter ihrem Kopf heraus, wandte sich an sie, schüttelte den Kopf, lächelte und sagte: „Hadil, du bist ein Verhängnis!“ Und sie kicherte vergnügt.
„Wir sind da“, unterbrach Amer ihre Gedanken. Er lächelte zufrieden, als hätte er eine schwierige Aufgabe gelöst. Die Fahrt von Ramallah zur Allenby-Brücke dauerte etwa eine Stunde. Sie waren problemlos durch zwei weitere Checkpoints – Checkpoint Dschabba, östlich von Kalandia, und Checkpoint Mussa Alami, südlich von Jericho, in der Nähe des Kasinos – hindurchgefahren. Sie bedankte sich, bezahlte und fügte ein gönnerhaftes Trinkgeld hinzu. Sie machten miteinander ab, dass er sie hier abholen würde, wenn sie zurückkäme. Sie schaute dem sich entfernenden Wagen nach, auf dessen Heckscheibe zwei Kleber befestigt waren: „Bete zum Propheten!“ und „der Hidschab, meine Schwester!“
Jetzt musste sie nur noch die israelische und die jordanische Passkontrolle passieren. In solchen Momenten rügte sie sich dafür, dass sie sich weigerte, sich um einen VIP-Schein zu bemühen, die es den Persönlichkeiten der palästinensischen Autonomiebehörde und ihren Verwandten ermöglicht, besser behandelt zu werden. Als Aridsch ihr einmal erzählte, unter der Hand, dass ihr Mann Baschir Leute in der Autonomiebehörde kenne, und auch welche im jordanischen Regierungsapparat, und dass er ihr so einen Schein besorgen könne, wies sie das ab, da es ihr unangenehm war.
„Was hast du denn?“ rügte sie Aridsch. „Jeder, der kann, besorgt sich so einen Schein.“
„Sollen sie gesund sein“, sagte sie und hob trotzig ihren Kopf.
Die Passkontrolle ging an beiden Enden der Brücke ohne Schwierigkeiten und ohne zermürbendes Verhör schnell vorbei. Sie bestieg den Bus, der für die aus den Städten der Westbank kommenden Studenten bereitstand, und erreichte das Hotel auf der jordanischen Seite des Toten Meeres.




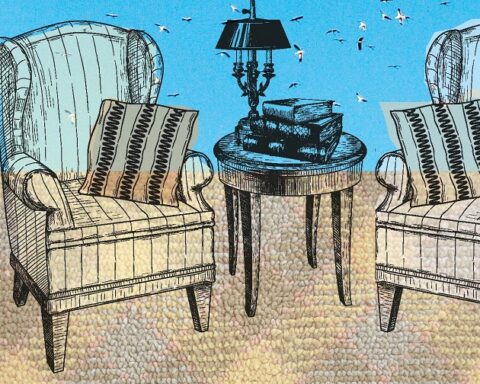






Sehr schoen geschrieben und uebersetzt! Das Buch ist nur 5 Jahre alt, erscheint einem heute als ob es eine Realitaet beschreibt, die Jahrzehnte zurueckliegen, als Israelis nach Jericho fuhren, um im hier erwaehnten Kasino zu spielen, oder in Jenin Hummus zu essen, und sich zumindest manchmal interessierte, wie wohl das Leben “auf der anderen Seite” aussieht, insbesonders wenn man der inzwischen endgueltig beerdigten Arbeiterpartei, wo Jona Mitglied war, nahestand. Und auch die interne palaestinensische Realitaet war anders, ihre Helden waren säkulare Freiheitskämpfer, Poeten und Sänger, heute ist in beiden Gesellschaften das religiöse Element das Ausschlaggebende…
Zwei Fragen an den Autor: ist er mit Arabisch als Muttersprache und den hier erwähnten irakischen Sänger aufgewachsen? Und – ist der Roman von wahren Geschichten inspiriert?
Antwort des Autors: Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem irakisches Arabisch gesprochen wurde. Das literarische Arabisch lernte ich an der Universität in den USA; arabische Musik war in meinem Elternhaus präsent; ein beträchtlicher Teil der beschriebenen Ereignisse im Roman hat sich tatsächlich ereignet, ein anderer entsprang meiner Fantasie. Die Feldforschung für die Vorbereitung dieses Romans enthielt viele Besuche in Ramallah und in den Dörfern ringsum.