„Dinge, die ich auf dem Boden fand“ (Ahuzat Bait, 2020) ist eine Memoiren-Novelle in erster Person über wichtige Stationen im Leben der Erzählerin: Ihre Versuche, ihre Mutter dazu zu bringen, über den Krieg von 1948 zu erzählen und was sie damals als Soldatin gemacht hat; die Beziehungen zwischen ihrem Großvater und einem palästinensischen Grundstückhändler, der danach wegen dieser Tätigkeit ermordet wurde; ein Treffen mit dem toten palästinensischen Schriftsteller Emil Habibi; ihre Teilnahme an der XX. Olympiade in München 1972, als elf israelische Sportler ermordet wurden. Im folgenden Abschnitt aus dem Kapitel über die Olympiade wird Shaul Ladany erwähnt. Er überlebte das KZ Bergen-Belsen, und überlebte 27 Jahre danach das Massaker in München. Esther Schachamorow ist unter anderem im Dokumentarfilm „Ein Tag im September“ vom Jahr 1999 zu sehen.
Auch in diesem Buch steht neben den menschlichen Beziehungen Gorneys große Liebe zur Natur im Vordergrund.
Im Juni publizierten wir hier drei Auszüge aus Gorneys drittem Buch „Zoologisches Porträt: Lexikon“. Edna Gorney beschäftigt sich mit Naturschutz und ökologischer Forschung im Bereich des Vogelzugs und des Vogelgesangs. Sie hat einen Doktortitel in Verhaltensökologie und unterrichtet Gender studies in der Universität Haifa. Sie ist Redaktorin in der hebräischen Zeitschrift „Ökologie und Umwelt“ und zuständig für die Rubrik „Gesang der Umwelt“. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter.
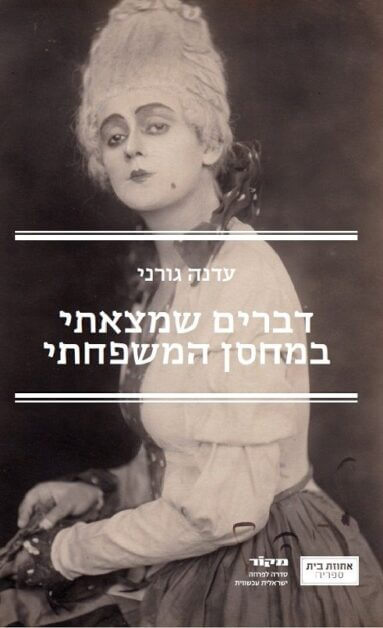
Die XX. Olympiade, München 1972
(aus: „Dinge, die ich auf dem Boden fand“)
von Edna Gorney
Übersetzung: Uri Shani
Das Auge braucht etwas, worauf es schauen kann, etwas Konkretes, das die schweren Räder der Erinnerungsmaschine antreiben kann, denn das sind Räder, die es jetzt vorziehen, still zu liegen und zu schweigen. Es behagt ihnen zu ruhen. Eine weiße Tasche mit einem Reißverschluss. Auf der Tasche, schwarz, das olympische Symbol, fünf ineinander verschlungene Ringe und die Aufschrift: Spiele der XX. Olympiade, München, 1972 (auf Deutsch). Eine Tasche mit einer farbigen Aufschrift war zu teuer. Mit dem Geld, das ich gespart hatte, hatte ich weiße Laufhosen mit demselben Symbol gekauft. Die Hosen sind noch in meinem Schrank. Ich trage sie nicht, heute. Eigentlich trug ich sie gar nie.
Nein, das ist nicht wahr. Die Dinge, die Formulare, die Briefe, sie erwecken die Erinnerung nicht, sondern ergänzen und erfinden sie, füllen mit Farbe die weißen Flecken in der Landkarte des Gedächtnisses, stellen aus Abschnitten eine zusammenhängende Kontinuität her, fügen die Stückchen zusammen, die die Zeit in alle Windrichtungen verweht hat. Wie nach einer atomaren Bombardierung verbreiten sie weiterhin eine radioaktive Ausstrahlung. Ich betätige einen Geigerzähler. Ziehe aus einem Umschlag eine offizielle Bestätigung der olympischen Kommission in Israel, gerichtet an den Kommandanten des Rekrutierungsamtes des israelischen Militärs. Fünf farbige Ringe schmücken den Briefkopf: „Wir bestätigen hiermit, dass … ID-Nummer… Teil der Spitzensportler ist, die am internationalen Jugendlager teilnehmen werden, im Rahmen der Olympiade, die im Sommer in München stattfinden wird. Die Gesandtschaft wird als Gruppe hin- und wieder zurückfahren. Dauer des Lagers: vom 16. August bis zum 15. September 1972. Wir bitten Sie, der Obengenannten die Teilnahme die zu ermöglichen. Unterschrift: Ch. Glubinski, Ehrensekretär.“
Die erste Postkarte schrieb die Obengenannte, das heißt ich, meiner Großmutter, am 28. August. Ich erzählte, dass wir eine wunderbare Zeit haben und die besten Sportler auf der Welt sehen. Ich erwähnte einen kurzen Ausflug nach Österreich. Alles im Plural, wir haben, wir machen, wir sehen. Ich versprach: „Mehr Einzelheiten im Brief“. Meine Oma hat Briefmarken und Postkarten gesammelt, der Brief ist nicht erhalten. Vielleicht wurde er nie geschrieben.
Wenn man mich fragen würde, wann ich zu laufen begann, finde ich in meinem Gedächtnis meinen ersten Sieg im 300-Meter-Lauf. Ich war ein neues Mädchen in jener Schule. Ich besiegte die Klassenbeste, die auch die unbesiegbare Laufbeste war. Ich war mir vielleicht der tieferen Bedeutung dieses Sieges nicht bewusst, und vielleicht dachte ich nicht, dass ich gewinnen würde, oder vielleicht wollte ich sehr gewinnen und hoffte, der Sieg würde mich aus meiner Isolation befreien – ich war die Giraffe oder das Streichholz – und meine Sehnsucht nach den Freundinnen aus der alten Schule kurieren. Kurz vor der Ziellinie überholte ich sie, und ich sah die zuschauenden Mädchen, wie sie zu uns liefen. Ich dachte, sie würden mich für meinen Sieg beglückwünschen, aber sie kamen nicht zu mir – ich drehte mich um und sah, dass die Besiegte zusammengebrochen war, und alle Mädchen standen um sie herum. Ich wurde nur mit rügenden Blicken gewürdigt, die mich anklagten: „Schau, was du ihr angetan hast!“ Ich wollte mich entschuldigen und weinen, ich atmete übertrieben schwer, damit sie auch mit mir ein bisschen Mitleid hätten, aber vor allem wollte ich wieder die sein, die ich vor diesem Tag war, vor diesem Moment, vor dem sportlichen Sieg, der eine soziale Niederlage war.
In München wohnten wir im Dorf für junge Spitzensportler, neben dem „wahren“ olympischen Dorf. Es herrschte strikte Ordnung. Eine hellblaue Identitätskarte gab uns Eintritt in unser Dorf und ins olympische Dorf. Meine ID-Nummer war 01184. In der ID-Karte waren ein Foto und die normalen Einzelheiten – Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsland und Nationalität. Die ID-Karte war vom 16. Juni bis zum 15. Oktober 1972 gültig. Es stand dort auch „Olympic Youth Camp“, und auf Deutsch: „Olympisches Jugendlager“. Ich betrachte die ID-Karte, das Foto mit dem jungen Gesicht, und stolpere über das Wort „Lager“. Wie kann man nur dies Wort benutzen, man hätte aufhören sollen, es zu auszusprechen, es aus der deutschen Sprache entfernen, in den Ruhestand setzen. Ich schließe die Karte und sehe wieder, oder vielleicht zum ersten Mal, dass auf dem Umschlag nicht das ganze Wort Jugend aufgedruckt ist, sondern nur der Buchstabe J.

Im Umschlag ist auch eine Liste der athletischen Spiele, die am 7. September 1972 stattfinden sollen. Auf Seite 20 – Halbfinal Frauen in hundert Meter Hürdenlauf. Acht Frauen in jeder Gruppe. Esther Schachamorow ist in der zweiten Gruppe. Die ersten vier in jeder Gruppe werden im Finale mitmachen.
In meinem Fotoalbum sind Schwarz-Weiß-Fotos. Die israelische Fahne zwischen den Fahnen der Delegationen in der Eröffnungszeremonie des Jugendlagers. Tamar und ich vor den riesigen Ringen. Wir tragen beide die offiziellen Kleider, eine Bordeaux-farbene Weste, wenn ich mich recht entsinne. Ich sehe den Schrank in der Wohnung in Tel-Aviv, wo meine Mutter noch immer wohnt. Die Kamera nähert sich, die weiß gestrichenen Türen öffnen sich, das Bordeaux in gutem Kontrast zum weiß. Schon Jahre, dass sie im Schrank hängt – meine Mutter bewahrt alles auf. Für den unteren Teil erhielten wir junge Frauen verschiedene Optionen. Tamar in langen dunklen Hosen. Ich in einem kurzen Minirock und weißen Strümpfen bis zu den Knien. Mein Kennzeichen, sogar in Wettkämpfen. Tamar mit dem Rücken zur Kamera, ich lache, esse etwas. Ein Farbfoto von Yuval und Schaul, dem Rothaarigen, in einem Boot auf dem See. Tamar zwischen den beiden, in Schatten getaucht, ihr Gesicht kaum sichtbar. Schauls rotes Haar leuchtet auf dem Hintergrund des blauen Wassers. Ich erinnere mich nicht an einen Ausflug an einen See. Erinnere mich nicht an den Ausflug nach Österreich, von dem ich in der Postkarte an Oma schrieb. Noch ein Foto mit Tamar, Yuval und Naama auf der Tribüne des olympischen Stadions. Ich kann mich nicht erinnern, wer Naama ist, aber das steht hier im Album. Noch drei Fotos. Die Delegation in der Eröffnungszeremonie der Olympiade, der Startsprung des 800-Meter-Laufs Männer, Wettlauf Gehen 50 km. Unter dem Foto, das von den billigsten Plätzen ganz hinten auf der Tribüne des riesigen Stadions geschossen wurde, steht in Handschrift: „Wo ist Dr. Shaul Ladani?“ Die Geher wie kleine Insekten, erstarrt an ihrem Standort und mit Reißnägeln an meine Gedächtnisblätter geheftet. Keine Daten. Man sieht gut die vollen Tribünen und darüber ein Dach, wie ein riesiges Zelt. Das ist es, was ich habe. Sieben Fotos. Ich erinnere mich nicht, wann ich die Fotos ins Album geklebt und die kurzen Kommentare auf kleinen Zetteln hinzugefügt habe; wann ich genug vergessen oder genug ignorieren, so machen konnte, als sei nichts geschehen; wann ich diese Fotos in ein normales Fotoalbum stecken konnte, das mit dem Ausflug auf den Chermonberg im Januar 1972 mit den Pfadfindern begann (Yaakov und ich lachen in der Ecke des Fotos) und mit der Fahrt nach Leverkusen in Deutschland im Juni 1972 weitergeht. Das war vor München, als eine Reise ins Ausland nur eine Reise ins Ausland war. Später im Album der Zivildienst, Ausgrabungen an der Klagemauer in Jerusalem. Ich halte inne und betrachte ein Foto, das ich besonders liebe – der Moment der Übergabe des Stabes im Staffellauf. Die Hand der hinteren Läuferin ist nach vorne ausgestreckt, hält noch den Stab, und ich strecke meine Hand nach hinten aus, mit einer Mischung von angespanntem Muskel, genauem Timing und der Hoffnung und dem starken Willen, weiterzumachen und den Stab weiterzureichen. Und hier ist schon das Jugendlager der Olympiade München. Und danach die anderen Reisen im Sommer 1973 mit dem Maccabi-Team und der israelischen Mannschaft, eine ungestörte Folge in der Routine des Lebens.
An den Wettlauf, an dem Ladany teilnahm, erinnere ich mich gut. Ich war stolz darauf, dass ich helfen konnte, als nähme ich selber an der Olympiade teil. Es gab einen besonderen Tisch, an dem die Gehenden vorbeigingen. Man gab mir ein Fahrrad. Ich musste Ladany treffen, bevor er den Tisch erreichte und ihn fragen, welches Getränk er wolle. Was er trank, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Coca Cola, mit verschiedenen Dosierungen von Glukose. Er rief mir zu, wieviel Glukose er will, und ich fuhr mit dem Fahrrad hin und berichtete. Die Geher kamen, schnappten sich die Flasche, tranken und warfen sie weg, alles während des Gehens. Jemand sammelte die leeren Flaschen ein. Der Wettlauf dauerte vier Stunden. Einmal, als ich auf Ladany wartete, sah ich von weitem einen der Geher, wie er die Hosen runterließ und sich in den Büschen entleerte. Ein Dilemma, an das ich nicht gedacht hatte. Ich lief 400 und 800 Meter, alles ging nach ein oder zwei Minuten vorüber.
In das Album klebte ich nur Fotos, und wer die Zusammenhänge nicht kennt, erfährt sie nicht vom Album. Die restlichen Dokumente steckte ich in einen Umschlag, der nach all den Jahren vergessen ging. Ich weiß nicht, wer all die Zeitungsausschnitte, Briefe und Formulare sammelte. Meine Mutter bewahrt alles auf. Ich ziehe die „Bild“-Zeitung vom 7. September 1972 hervor, dem Tag, an dem Esther Schachamorow im Halbfinal des Wettlaufens hätte teilnehmen sollen. Der Preis der Zeitung: 30 Pfenning. Das Titelblatt ist bedeckt mit den Fotos der elf ermordeten Sportler. Unter ihnen Amitzur Shapira, Schachamorows Trainer, zweiunddreißig Jahre alt. Ich bin verwundert, wie jung er war. Er war auch mein Trainer, und als ich mit ihm zu trainieren begann, war ich dreizehn Jahre alt, und ich dachte, er sei ein älterer Herr. Jetzt bin ich dreißig Jahre älter als er. Amitzur war ein sehr engagierter Trainer. Ich finde eine Postkarte, die er mir am 13. Januar 1969 schickte. „Morgen früh verreise ich zu einem Leichtathletik-Trainerkongress in Athen, Griechenland. Ich möchte mich versichern, dass Du weiterhin trainierst, sowohl alleine als auch im Stadion in Tel-Aviv.“ Wir trainierten damals im heruntergekommenen Maccabi-Stadion neben dem alten Hafen von Tel-Aviv, der auch damals schon heruntergekommen war, zwischen den Garagen, den Schrotthaufen und den Montana-Eisständen, wie eine Rose unter den Dornen [Hohelied 2,2. U.S.], dort machten wir nach dem Training eine Pause, leckten ein Vanilleeis mit Beerensaft, meine Wahl seit eh und je. Mit Esther Schachamorow schämte ich mich zu sprechen, ich schaute auf sie hinauf – Göttinnen himmelt man von sicherem Abstand an. „Trainiere weiterhin mit aller Energie auch zu Hause, vor allem den Feldlauf. Auf Wiedersehen, grüße die Eltern, Amitzur.“ Ich habe auch noch ein Telegramm, das er am 12. Dezember im selben Jahr schickte. „Der Wettkampf findet am Samstag in Wingate statt. Amitzur Shapira.“
[…]
Meine Großmutter bewahrte den Umschlag auf, den ich ihr schickte und auf dem sich ein besonderer Stempel befindet. Der Postbeamte kam ihrer Bitte nach, dass der Stempel klar sein solle. Ich betrachte ihn jetzt, er ist immer noch ganz klar. 26. August 1972, Tag der Eröffnung der olympischen Spiele. Auf dem Umschlag ein riesiger Kleber und darin vier Briefmarken, die zusammen eine Zeichnung des olympischen Dorfes ergeben, mit allen Stadien und dem See. Vielleicht ist das der blaue See, wo ich Yuval, Tamar und den Rothaarigen fotografierte? Das olympische Dorf wurde in vier Kilometer Entfernung vom Stadtzentrum gebaut, wo nach dem Zweiten Weltkrieg die Bombardierungstrümmer konzentriert wurden. Die Trümmer bildeten einen „Berg“, mit einer Länge von mehr als einem Kilometer und einer Höhe von sechzig Metern. Den Berg ließen sie stehen, und daneben gruben sie einen künstlichen See. Mit der Erde, die herausgeschaufelt wurde, wurde der Trümmerberg bedeckt, und so wurde der olympische Hügel gebildet und die Parkflächen, wo das Stadion, die anderen Gebäude und die Wohnhäuser gebaut wurden. Willi Daume, der Präsident der Deutschen Olympischen Kommission, sagte, die olympischen Spiele in München werden als „heitere Spiele“ in Erinnerung bleiben.




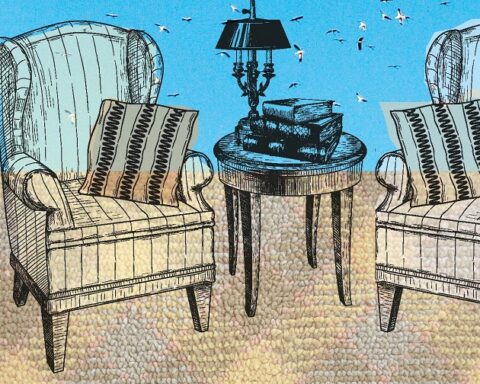






Das Ende dieses Ausschnitts („heitere Spiele“) ist wie ein Pfeil ins Herz…
Zum oben erwaehnten Emil Habibi sollte vielleicht hinzugefuegt werden, dass er nicht nur ein „toter palaestinensischer Schriftsteller“ war, sondern erstens weltweit renommiert, und zweitens in Israel lebender Palaestinenser mit israelischer Staatsbuergerschaft war, der den „Israel-Preis“ (den hoechsten Preis in Israel) fuer sein Buch „Ha-Opsimist“ (eine Mischung aus Optimist und Pessimist) erhielt, der die Ambivalenz dieser multiplen Identitaet (israelisch, arabisch, palaestinensisch und in Habibis Fall auch kommunistisch) beschreibt – vielleicht kann man hier mal einen Ausschnitt des „Opsimist“ veroeffentlichen?
„Ha-Opsimist“ heißt Habibis Buch nur in der hebräischen Übersetzung. In der deutschen Übersetzung von Ibrahim Abu Hashhash (Lenos-Verlag, 1995) heißt es: „Der Peptimist oder von den seltsamen Vorfällen um das Verschwinden Saids des Glücklosen“. Im Gegensatz zu Edna, die Habibi nur imaginär getroffen hat, sass ich mit ihm im Juni 1989 in (damals gerade noch knapp West-)Berlin auf der Bühne.
Ueber dein Treffen mit Habibi in Berlin wuerde ich gerne lesen! Uebrigens wurde das Arabische „Mutasha’el“ (Mixform aus Optimist und Pessimist) in den meisten europaeischen Uebersetzungen (zB englisch, spanisch, franzoesisch) als „Opsimist“ uebersetzt, nur in deutsch nicht…