Wer hat Angst vor dem „Kaffeekränzchen Tod“?
Alle paar Wochen, nach Sonnenuntergang, treffen sich vierzehn Frauen und Männer, um Kaffee zu trinken und über den Tod zu sprechen.
Das ist nicht der Beginn eines gruseligen Romans mit einer erfundenen Geschichte, diese Treffen haben tatsächlich im Haus von Professor Amia Lieblich stattgefunden, und hier wurde über das größte Tabu der westlichen Gesellschaft gesprochen: der unausweichliche Tod von jeder und jedem von uns.
Seit einem Jahrzehnt gibt es solche „Kaffeekränzchen Tod“ in aller Welt. Nachdem sie davon erfuhr, übernahm Amia Lieblich sofort das Konzept: Über den Tod sprechen, seine Heimlichkeit anfechten, vielleicht sogar eine seelenruhige Beziehung mit ihm erreichen. Sie veröffentlichte eine Einladung zu dieser Gruppe und prompt waren schon Dutzende von Kandidaten da – Menschen in jedem Alter, in allen möglichen Berufen, mit verschiedenen Interessen und Lebensgeschichten – und bald begannen die Treffen.
Das Buch „Kaffeekränzchen Tod“ (Verlag Dvir, 2019) beschreibt eine der Gruppen, die sich im Jahr 2016 traf: eine Gruppe von Frauen und Männern, die auf eine gemeinsame tiefgreifende und stürmische Seelenreise in einem geschlossenen Zimmer ging; eine Reise, die ein Jahr lang andauerte, aufgenommen und niedergeschrieben wurden. Wir kennen den Tod nicht, niemand ist von ihm zurückgekehrt, um von ihm zu erzählen; die westliche Welt hat ihn in Krankenhäuser und Pflegeheime verdrängt, und seine Anziehung ist in seiner Macht vergleichbar mit der Angst, die er auslöst. Die aufwühlenden und ehrlichen, lustigen und traurigen Gespräche in diesem Buch erinnern uns daran, dass das Todesbewusstsein auch das Leben schärfen, seine Schönheit und seinen Wert erhöhen und eigentlich uns lehren kann zu leben.
Professorin Amia Lieblich, Jahrgang 1939, Rektorin des akademischen Colleges in Netanja, ist eine der wichtigsten und interessantesten Forscher der Psychologie der israelischen Gesellschaft. Ihre Arbeiten, die alle Gemeinschaften und Phänomene der israelischen Gesellschaft umfassen, haben ihr eine Reihe von Preise gegeben.

Kaffeekränzchen Tod
von Amia Lieblich
Übersetzung: Uri Shani
[Das Buch hat 400 Seiten, der folgende Abschnitt ist von den Seiten 276-181.]
Riwka: Ich habe Michael noch nie weinen sehen.
Ajelet: Denn wenn du zu weinen beginnst – dann hat das kein Ende mehr. [zu Michael] Aber ich verstehe wirklich nicht, wie man solche Dinge überleben kann! Ich meine, was hält dich am Leben? Woher die Kräfte, das Licht? Warum hast du dir gesagt, man kann ja später noch in den elektrischen Zaun springen, und hast es verschoben, und andere sind schon gesprungen? Aus dem, was ich lese, verstehe ich, dass es etwas mit Bedeutung zu tun hat. Victor Fraenkel spricht darüber. Wenn mein Leben eine Bedeutung hat, auch wenn momentan mein Leben unmöglich ist, dann kann ich mich an diese Bedeutung klammern. Wenn ich das Gefühl habe, dass es nichts gibt, wofür ich überleben sollte, dann ist es wirklich egal.
Michael: Mein Leben hat seine Bedeutung nicht von Victor Fraenkel erhalten, sondern von meiner Mutter. Als ich klein war, sang sie mir ein Lied: [auf jiddisch] Noch der Rejgen schejnt die Sonn zierjck – nach dem Regen scheint wieder die Sonne. Und das hat mich während all dieser schrecklichen Zeit begleitet. Eine Hoffnung.
Ruth: Was war klar für dich?
Michael: Dass … die Kontrolle wieder zurückkommen wird. Wenn du neben der größten Todesfabrik sitzst, und du siehst Flugzeuge über dir, und sie bombardieren das Lager nicht, sondern woanders, dann, na ja, die Welt hat dich verlassen! Später habe ich einen öffentlichen Prozess in Jerusalem veranstaltet, über das Thema: Warum wurde Auschwitz nicht bombardiert? Und vielleicht werdet ihr erstaunt sein, aber der Grund war Antisemitismus. Da war dieser Loyd, der amerikanische Staatssekretär, und auch Roosevelt war kein großer Judenliebhaber, und ihre Antwort war, dass, wenn dann alle befreit wären, und der Krieg zu Ende sei, dann werdet auch ihr befreit. Aber er hat vergessen, dass man die ganze Zeit vernichtet hat. Das war ein Gefühl von Verlassenheit, Preisgabe.
Riwka: Dann war es also genau umgekehrt. Dann – woher also die Hoffnung?
Michael: Von meiner Mutter.
[Was für eine unglaubliche Antwort. Seine Mutter wurde ja ermordet. Aber die Mitglieder der Gruppe lassen nicht los.]
Ruth: Sonne nach dem Regen ist ein Sinnbild. Aber wie war es wirklich für dich, die Hoffnung? Was? Dass du Falafel in Israel essen wirst?
Michael: Wenn ichs dir erzähle, wirst du lachen. Aber es ist wahr. Wir waren eine zionistische Familie, zu Hause erhielten wir die jüdische Zeitung, und wir wussten genau, was in Palästina vor sich geht. Wir wussten, dass wir dorthin kommen. Meine Schwester musste noch das Medizinstudium beenden, deswegen verschob sich das, aber wir wussten, dass es am Schluss kommen wird! Und als es ganz schlimm wurde – das ist keine Legende – dachte ich an Eretz Israel, an die Sonne und die Orangen dort. Ich, auf dem Haufen von Toten in Auschwitz, sah die Bäume blühen in Eretz Israel. Das tönt jetzt sehr wie Phrasen, aber das war so. In meinen Augen sah ich Eretz Israel. Ich meine, ich wusste, dass ich dorthin komme.
[Ich bin fassungslos von der Gewalt von Michaels Antwort und von ihrer Einfachheit, und es scheint, dass die meisten in der Runde es auch sind. In die Stille dringt Awitals Stimme:]
Awital: Für mich tönt es sehr realistisch, denn auch meine Mutter hat immer so etwas erzählt. Sie war seit der dritten Klasse in einer Schule des Netzwerks „Tarbut“, und dann im hebräischen Gymnasium in Rovno, aber für sie gab es nur Eretz Israel und die Kibbutzim im Jordantal. An jedem Tag wussten sie, was gerade gepflanzt wird, und was sonst alles geschieht, und sie lebten in ihrer Fantasie hier. Sobald es möglich war, kamen sie – sie hatte das Glück, dass sie 1935 ein Zertifikat erhielt. Aber sie „lebte“ hier schon vorher. Sie beschrieb es ganz genau – wie du dich die ganze Zeit in deiner Fantasie in einem Kibbutz im Jordantal erlebst, obschon du dort bist, in Rovno.
Michael: Deswegen hatte ich kein Problem… danach schiffte ich mich auf einem Schiff der illegalen Einwanderung ein und kam ins Land. Ich sprach Hebräisch. Ich bestieg einen Bus mit einem arabischen Fahrer nach Beer Tuwia und stieg dort aus. Es war Nacht, und der Wächter fragte mich: Was machst du hier? Und ich sagte: Ich möchte hier leben! Er nahm mich zu einer Frau, die sich mit Kindern beschäftigt, und sie sagte, bring ihn zum Lehrer Schimon, und morgen bring ihn in die sechste Klasse. Und ich hatte in Kovno nur die erste Klasse beendet! Sie hat beschlossen, dass ich die Klassen überspringe… Ich sprach Hebräisch in sephardischer Aussprache, und ich hatte kein Integrationsproblem! [Diejenigen, die die hebräische Sprache wiederbelebt haben und das Neuhebräisch bildeten, kamen aus Europa, aber sie beschlossen, dass es in sephardischer Aussprache gesprochen werden soll, so wie es die Juden aus Nordafrika und den Nahen Osten sprachen, im Gegensatz zur aschkenasischen Aussprache, so wie es die europäischen Juden in den Gebeten während der Generationen weitergegeben hatten. Der Übersetzer] Ich fuhr in arabischen Bussen, ich ging in den Markt – Pugi-Geschichten. [In diesem Zusammenhang eigentlich ein anachronistischer Ausdruck. Er bezieht sich auf die „mythologische“ Schallplatte „Pugi-Geschichten“ der Band „Kaveret“ aus dem Jahr 1973 mit lauter absurden, aber sehr israelischen Anekdoten, zu Songs vertont. Der Übersetzer] Aber ich war angekommen, und das war mein Ziel und mein Weg. Danach war mein Bruder im Palmach, und ich wollte in Mikwe Israel in die Schule gehen. Ich hatte kein Geld, um das zu bezahlen. Ich ging zum Generalstabsquartier des Palmach und fragte: Wo ist mein Bruder? Ich brauche Geld. Sie fragten mich: Wofür? Ich sagte: für die Schule. Da vergingen nicht mehr als fünf Minuten, sie gaben mir eine Wollmütze [ein „Kennzeichen“ des Palmach, der Ü.] und eine Anstecknadel des Palmach und brachten mich in einem Jeep nach Mikwe Israel, mit einem Umschlag bewaffnet. Ich studierte auf Kosten des Palmach, ich war der Einzige. [lacht] Ich habe auf jeden Fall nichts und niemandem erlaubt, mir im Weg zu stehen. Und bis heute, ich bin jetzt vierundachtzig, Bambino, und ich mache alles, arbeite, lerne, fahre Auto – in der Nacht, am Tag, im Wind… ihr könnt mich auslachen – aber wenn mir etwas schwerfällt, sag ich mir, Micha, die SS ist hinter dir her, gleich schießen sie auf dich! [lacht]
Ofer: Du hast die größte Hürde im Alter von zehn Jahren gemacht. Der Rest ist dann leicht!
Riwka: So zieht er mich in den Ausflügen hinter sich her!
Michael: Ich studiere heute die Fächer Genozid, Faschismus, Geschichte der Gegenwart – ich studierte nicht hebräische Literatur oder Kunst. Bis heute interessiert mich dieses Thema.
Amia: In der Psychologie gibt es den Begriff der Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit, die manchmal ans Unverwundbare grenzt. Es gibt Menschen, die haben das – in ihren Genen, oder von ihrer frühen Kindheit, nicht ganz klar, woher das kommt. Sie haben Kräfte. Die springen nicht so schnell auf den elektrischen Zaun. Das ist ein Geschenk, nicht jeder hat das. Aber wir alle, denke ich, haben mehr Kräfte, als wir denken, wie auch Adina sagte.
Michael: Du hast recht.
Amia: Wenn es die Situation erfordert – dann manifestieren sich plötzlich diese Kräfte. Das ist etwas Wunderbares.
Riwka: Und vielleicht ist es das, das wir von diesem Abend mitnehmen können. Wir haben mehr Kräfte, als wir denken.
Schira: Aber nicht jeder. Es gibt solche, die auf den elektrischen Zaun springen. Es gibt solche, die es nicht schaffen. Sie geben auf, sie werden depressiv. Also was macht den Unterschied aus? Man kann auch sagen, dass jeder Dinge hat, die ihn stärken und andere, die ihn schwächen.
Michael: Ich denke immer an diesen Satz, den die Deutschen sagen: [auf deutsch] Geld verloren – Geld verloren, Hoffnung verloren – alles verloren.“
Schira: Schön. Guter Satz.
Michael: Mein Vorteil war vor allem, dass ich keine Familie hatte. Ich hatte keine Großmutter, die ich pflegen musste, keine Mutter, Tante, kleinen Bruder.
[Ich denke bei mir: pflegen ist natürlich gegenseitig – die Großmutter hat dich nicht gepflegt, und auch du musstest nicht Rücksicht nehmen auf Gefühle der Sorge ihrerseits… ich hatte schon von Überlebenden diese These gehört – von solchen, die jung waren, als der Krieg ausbrach – , dass sie dank der Tatsache, dass sie frei waren von der Sorge um Andere, überlebt hätten.]
Ruth: Du warst ja selber noch ein Kind.
Ajelet: Manchmal gibt dir gerade die Verpflichtung, sich um ein Kind zu sorgen, wie in meiner kleinen Geschichte, viel Kraft.
Schira: Genau! Manchmal gibt dir die Familie Kraft, und manchmal ist gerade die Tatsache, dass du keine Familie hast, dass du alleine bist, ein Vorteil. Das ist nicht konstant.
Michael: Ich kann es wirklich nicht sagen, ich hatte es gut ohne Familie, warum habe ich eine Familie gegründet? [lacht]
Riwka: Der ist doch der Hammer!
[Die vorbestimmte Zeit, wann das Treffen zu Ende ist, ist schon vorbei, aber keiner macht eine Gebärde, die darauf hinweisen könnte.]
Amia: Vielen Dank, Michael, es ist wirklich ein großes Glück, dich zu hören. Du bist inspirierend.




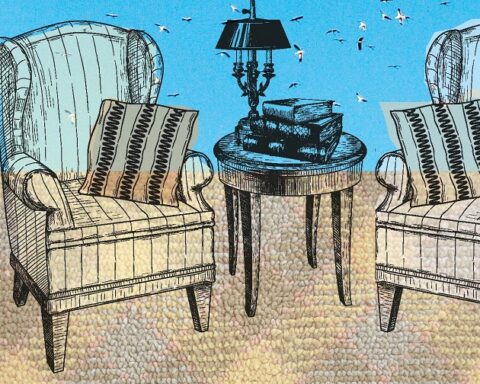






Sehr interessantes Konzept, dieser „Todes-Kaffeeklatsch“: es erinnert mich an den Dokumentarfilm מועדון בית הקברות (the cemetery club) von Tali Shemesh ueber Holocaustueberlebende, die sich einmal die Woche beim Herzl-Friedhof in Jerusalem treffen, um ueber Gtt und die Welt zu reden. Hier der Trailer: https://m.youtube.com/watch?v=fa_B175KSis
(Ist der „Friedhofsclub“ nicht der Club, in den jeder von uns einmal eintreten wird?)