„Das Geheimnis“ ist eine von 29 kurzen Geschichten im Buch „Berührungen“ (Carmel, 2021). Das Buch ist eine Weltreise in die Länder der ungelösten Dinge. Der Leser trifft in „Berührungen“ auf einen Zirkus aus dem Traumland am Strand von Saint-Tropez; auf einen Friedhof im Herzen eines Vulkans in Hawaii; auf einen sechsjährigen Knaben, der mit dem Premierminister in Jerusalem mit gereimten Briefen korrespondiert; auf Nietzsches Paradies in Sils Maria; auf ein Wunderkind, ein Mädchen, die das Schwimmbad von Santa Klara verbrennt, und mehr.
Moshe Oren ist Schriftsteller, Journalist und Redakteur. In den siebziger Jahren arbeitete er als Korrespondent in London und in den achtziger Jahren lebte er mit seiner Familie in Hawaii. Oren war der Erste, der das Land von Dan bis Eilat zu Fuß durchquerte, und sein Buch „Ein Mann begeht das Land Israel“ (1994) war das erste, das solch eine Wanderung beschrieb. Im ersten Jahrzehnt dieses Millenniums initiierte und leitete er einige der wichtigsten Erinnerungsstätten des Landes, darunter den „Verbindungsweg “ zwischen Yad-VaShem und dem Herzlberg in Jerusalem.
Mordechai Oren war ein führender Politiker der linkssozialistischen MAPAM. Er wurde 1951 in Prag verhaftet, gefoltert und gezwungen, im berüchtigten Slanski-Schauprozess auszusagen. Er saß viereinhalb Jahre im tschechischen Gefängnis.

Das Geheimnis
von Moshe Oren
Übersetzung: Uri Shani
Lektorat: Nina Ziny
Sie fahren mit dem Schiff in den See Genezareth, eineinhalb Kilometer weit hinein, um Kränze am Ort des Unglücks aufs Wasser zu legen. Kränze zum Andenken an die Toten. Noch bevor sie das Boot in Ein-Gev bestiegen haben, wendet er sich lächelnd an den Kapitän: „Heute habt ihr genügend Rettungsringe mit dabei?“ Der Kapitän lächelt ein wissendes Lächeln. Siebzig Jahre davor, in einer angenehm warmen Nacht im Jahre 1943, ereignete sich hier, in einem ähnlichen Boot, eines der schlimmsten Unglücke jener Zeit. Elf Frauen und Männer, Kibbutz- und Moschawmitglieder, starben hier auf dem Weg von Deganja nach Ein-Gev. Das Unglück wurde das „Milchbauernunglück“ genannt.
Es war das erste Landestreffen der Milchbauern. Die Teilnehmer kamen von nah und fern nach Deganja A, wo die erste Milchviehhaltung der Kibbutzim und Moschawim gegründet wurde. Die Großmutter seiner Frau, die die Milchviehhaltung in seinem Kibbutz gegründet hatte, war auch dabei. Und nach dem Kongress erhielten die Teilnehmer einen besonderen Preis: eine nächtliche Fahrt auf dem See Genezareth. Ein großes Boot kam aus Ein-Gev, hinter sich ein kleineres Boot herziehend. Am Strand stiegen bei Vollmond etwa zweihundert Mann und Frau auf die beiden Boote. Sie fuhren um neun Uhr abends hinaus, und schon bald begann das kleinere der beiden Boote, sich mit Wasser zu füllen. Etwa eineinhalb Kilometer vom Strand entfernt begann es zu sinken. Die Mannschaft des großen Bootes hatte keinerlei Erfahrung mit so einer Situation, und viele der Frauen und Männer im kleinen Boot, Flüchtlinge aus Osteuropa, hatten nie schwimmen gelernt. In der Dunkelheit entstand ein unheilvolles Durcheinander, und die Tragödie, in so einer Situation, war unvermeidlich. Die Überlebenden erreichten Ein-Gev auf dem großen Boot, und die ganze Nacht und am nächsten Tag wurde nach weiteren Überlebenden gesucht. Einige der Leichen wurden erst Tage danach geortet. Die Großmutter seiner Frau war eine von ihnen.
Siebzig Jahre danach, im selben Kibbutz Deganja, versammeln sich die Kinder der Opfer des Unglücks. Es ist ihr erstes Treffen, und nur wenige von ihnen haben jemals darüber gesprochen. Jetzt steigen sie auf die Bühne und sprechen. Alte Menschen, im achten Jahrzehnt ihres Lebens, erleben das Unglück von neuen. Und es ist unerträglich, auch heute noch. Und am schlimmsten von allem ist das Geheimnis.
Hadassa ist das einzige Kind ihres Vaters, der im Unglück ertrunken ist. Sie weiß nichts darüber, denn niemand wollte ihr jemals etwas erzählen. Papa ist nach Amerika gefahren, sagte man ihr. Jahre danach, als sie die Wahrheit erfuhr, erfuhr sie sie von den Kindern, ihren Kameraden.
Gideon besuchte den Kibbutz. Sein Vater, so erzählte er den anderen Kindern, ist in die Welt hinausgefahren und kommt bald zurück. Aber die anderen Kinder wussten schon lange, dass Gideons Vater im See Genezareth ertrunken ist und im Friedhof des Kibbutz begraben wurde. Sie verstanden nicht, wie es sein konnte, dass Gideon, sein Sohn, es nicht wusste.
Jardena war drei Monate alt, als sie ihren Vater verlor. Ihre Mutter heiratete nach drei Jahren einen anderen Mann, und Jardena rief ihn Papa, seit sie sich erinnern kann. Sie war neun Jahre alt, als einer der Buben in ihrer Gruppe, während eines Streites, ihr die Wahrheit ins Gesicht schrie. Jardena brach in Tränen aus und lief zu ihrer Mutter, und diese musste ihr nun alles gestehen.
Alte Menschen stehen auf der Bühne, vor dem Mikrophon und kämpfen gegen die Erinnerung und die Tränen. Einige schaffen es mehr, andere weniger. Tief im Innern sind die Wunden noch nicht verheilt. Seine Frau legt ihren Kopf an seine Schulter. Er legt seine Hand auf die ihre. Beide waren damals noch nicht geboren, als all das geschah, aber es fühlt sich nah, schmerzend nah an…
„Und dein Geheimnis“, flüstert seine Frau, „was ist mit ihm?“
Ein eiserner Vorhang des Schweigens. Sein Geheimnis, auch nach all den Jahren, ist ungelöst geblieben. Es begann mit den ersten Nachrichten über seinen Vater, Monate nachdem er spurlos verschwunden war. Im Sommer 1952 war schon klar, dass er im tschechischen Gefängnis saß, in Prag, und auf den Prozess wartete. Wofür man ihn beschuldigte und warum, das wusste niemand, aber er lebt, Gott sei Dank, und man weiß auch wo. Seine vierzehnjährige Schwester wusste es schon. Vor ihr konnte man es nicht verheimlichen. Aber was sollte man dem vierjährigen Knaben sagen? In der geschlossenen Gesellschaft des Kibbutz war dies keine Entscheidung, welche die Mutter selber fällen konnte. Alle Kibbutzmitglieder beschlossen gemeinsam und waren für die Umsetzung des Beschlusses verantwortlich. Im Allgemeinen sprach man damals nicht über Dinge, über die man nicht sprechen musste. Und niemand wollte einen vierjährigen Knaben verletzen, der ja, so schien es, länger ohne seinen Vater werden leben müssen. Niemand wusste, wann und wie das Ganze enden würde. Deshalb war es besser, man sagte nichts, und wenn der Junge fragen sollte, dann würde man ihm sagen, der Vater sei auf einer mehrjährigen Mission im Ausland.
Für solche Beschlüsse findet man natürlich keine Dokumentation (es sind immer mündliche Beschlüsse), aber viele Jahr danach fand er trotzdem, ganz zufällig, einen schriftlichen Beleg, und zwar im Tagebuch des damaligen israelischen Premierministers Mosche Scharet. In jener Nacht (am 12.4.1955) schrieb dieser in sein Tagebuch:
„R. kam mit ihrem kleinen Sohn zu Besuch […] der Junge ist jetzt sieben […] weiß nichts über das Schicksal seines Vaters, er glaubt, er sei in einer Mission und wartet auf seine Rückkehr.“
Und in der nächsten Nacht schrieb er:
„Der siebte Tag von Pessach. Ich habe mich morgens ein wenig mit dem Jungen befasst und meine Frau Zipora fuhr ihn und seine Mutter, zusammen mit Livia [seine Tochter, Livia Rokach. U.S.], die auch bei uns zu Besuch ist, zum Herzl-Berg […] Zu Mittag saßen R. und der Junge mit allen Besuchern, die zuvor gewarnt wurden, keine Fragen zu stellen, als ob alles in Ordnung wäre…“
Und das Geheimnis, so bezeugen die Tagebucheinträge des Premierministers, blieb bestehen. Jetzt, mit dem Beweis in der Hand, konnte er die Rechnung schließen. Im Frühjahr 1955 war sein Vater schon seit drei Jahren im Gefängnis, in Prag, und er war sieben Jahre alt.
Rückblickend, egal wie man sich die Geschichte anschaut, war es unglaublich. Nur schon die Anstrengung, die es brauchte, damit die Wahrheit nicht durchsickerte; von so vielen musste das Geheimnis gewahrt werden. Da sein Vater ein Thema war, worüber man nicht sprach, wurde ein Vorhang des Schweigens um den Jungen gewoben. Man sprach nicht „darüber“ mit dem Jungen, niemand: weder seine Mutter, noch seine Schwester, noch seine „Metapelet“, noch die Erzieher, noch die Nachtwächter im Kinderhaus. Man durfte über alles mit dem Jungen sprechen, nur nicht „darüber“.
Die Kinder in seiner Gruppe waren zwölf an der Zahl, und auch mit ihnen durfte nicht „darüber“ gesprochen werden. Und so gehörten in den Schweigekreis auch ihre Eltern (und auch die älteren Geschwister, wenn es solche gab), mit einer besonders hohen Vorsichtsmaßnahme beim „Vier-Uhr-Kaffee“, wenn die Kinder ihre Eltern besuchten. Dort gibt es Radio, und man hört Nachrichten…
Und die Zeitung. Wie um Gottes Willen versteckte man vor ihm die Zeitung?! Denn der ganze Kibbutz las ja DIE ZEITUNG („Al Hamischmar“), die jedes Kibbutzmitglied morgens erhielt. Und er, seit er sehr jung war, las alles. Alles, was ihm in die Hände fiel. Und die Zeitung sowieso (wegen der Sportmeldungen). Und da sein Vater, schon seit Jahren, die heißeste Story in den Nachrichten war (zweimal die Woche die Schlagzeile in der Zeitung), wie konnten sie es vor ihm verheimlichen? Und vor allen Kindern seiner Gruppe? Tatsache ist: Er wusste nichts. Und noch eine Tatsache: Auch sie wussten nichts. Drei Jahre lang.
Nach all den Jahren, je mehr er darüber nachdachte, kam er zum unvermeidlichen Schluss: Es waren nicht nur sie – auch er selber nahm daran teil. Manchmal WILL der Mensch etwas einfach nicht wissen, bewusst oder unbewusst. Und Tom Stoppard, der Dramatiker, den er am meisten liebte, konnte ein Beispiel dafür sein.
Er selbst war sieben Jahre alt, als er das Geheimnis lüftete. Tom Stoppard war 56! Und das ist besonders erstaunlich, da es sich um einen so gescheiten Menschen handelte, ein von Kind auf neugieriger („der klügste Mensch, dem ich je begegnet bin“, sagte Clive James).
Tom und sein nur wenig älterer Bruder wurden in der Tschechoslowakei geboren und hatten jüdische Eltern. Als der Krieg ausbrach, war die Familie in Singapur, und als die Japaner die Stadt belagerten, schickte der Vater die beiden Söhne in einem Schiff nach Indien (wenige Tage später fiel er einem Luftangriff zum Opfer). In Indien traf die Witwe einen britischen Offizier und heiratete ihn. Der Offizier, ein offener Rassist, verbat ihr, über ihre Vergangenheit und Herkunft zu sprechen. Kein Wort darüber, auch nicht mit den Kindern. Das Paar kam nach dem Krieg nach England, und die beiden Stoppard-Kinder wuchsen als englische Gentlemen auf. Tom selber, durch den Stil seiner Stücke und seine künstlerischen Entscheide, wurde zum britischen Gentleman der Bühne in London. Und seine Mutter bewahrte all die Jahre das Geheimnis.
Erst 1993 kam eine Verwandte aus Deutschland für einen geheimen Besuch ins Nationaltheater nach London. Sie zeigte Stoppard den Stammbaum seiner Mutter. An diesem Tag erfuhr er zum ersten Mal in seinem Leben von seiner tschechischen Vergangenheit und seiner jüdischen Herkunft. Nach einem weiteren Jahr, zu später Nachtstunde, als er von einem Schriftstellerkongress in Prag zum Hotel zurückkehrte, wartete ein junger Unbekannter mit einem alten Fotoalbum auf ihn. Der Mann, ein Enkel der Schwester seiner Mutter, machte ihn zum ersten Mal mit Fotos aus einer anderen Welt bekannt. Mit einer Vergangenheit, die er nie gekannt hatte. Seine Mutter als Kind im Haus ihrer Eltern. Seine Eltern als junges, lächelndes Paar. Und Dutzende von Verwandten, von deren Existenz er nie gewusst hatte.
Wie war das möglich? Ist es möglich, diese Vergangenheit zu verbergen, solche Tatsachen, von einem Mann wie Stoppard, und so lange? Es scheint keinen Sinn zu machen und nicht logisch zu sein. Und vielleicht tief im Innern wollte er es nicht wissen.
Sein eigenes Geheimnis blieb bis 1955 verborgen. Doch dann kam Dani.
Dani war ein „Außenkind“ („Yeled Chutz“), eines jener Kinder, die nicht im Kibbutz geboren waren deren Eltern nicht im Kibbutz lebten und von der Stadt in den Kibbutz kamen, um hier erzogen zu werden (mit der Zeit machten sie die Hälfte seiner Gruppe aus); er war älter als die Anderen in der Gruppe, klug und selbstsicher. Und Dani hörte etwas zu Hause, oder las etwas in der Zeitung, oder verstand eine Anspielung bei der Familie im Kibbutz, die ihn „adoptierte“. Auf jeden Fall fand Dani heraus, was vor sich ging. Und da er den Sinn nicht verstand, warum es vor ihm verborgen bleiben sollte, entschied er sich zu handeln. Aber was tun? Das war die Frage. Und wie? Die Lösung, die er fand, ist bis heute eindrücklich.
Damals benutzte man kein Toilettenpapier, jedenfalls nicht im Kinderhaus, und die Metapelet saß jeden Morgen da und schnitt die Zeitung in Stücke. Sie füllte das Holzkästchen in der Toilette, das an der Wand hing, mit Dutzenden schmalen, länglichen Streifen. Und auch hier wiederum musste sie aufpassen und darauf achten, was nicht in das Kästchen gelangen durfte. Und Dani, jedes Mal, wenn er die Toilette benutzte, fügte das Fehlende hinzu.
Denn Dani wusste, wie alle anderen auch: Der Junge liest viel. Alles, die ganze Zeit. Ja, auch in der Toilette. Und diese Zeitungsfetzen, im Holzkästchen an der Wand, sind das Einzige, was man hier lesen kann. Und so, mit unendlicher Geduld, steckte Dani Zeitungsartikel in seine Hosentaschen und spies das Holzkästchen mit der geheimen Information. Mit all dem, was die Erwachsenen vor dem Jungen verheimlichten. Und es klappte! Von seinem Sitz nahm sich der Junge ein Stück der verbotenen Zeitung und las….
Sechzig Jahre danach versucht er, dorthin zurückzukehren, zu diesem Moment. Was geschah damals in seinem Kopf? Was fühlte er? Fiel seine Welt zusammen? Sprang er auf und schrie? Eilte er ins Zimmer seiner Mutter (mit dem verräterischen Beweisstück in der Hand), um die ganze Wahrheit zu erfahren? Um seiner Verletzung Ausdruck zu geben?
Die Antwort auf all diese Fragen – so erstaunlich oder unmöglich es erscheinen mag – ist: nein. Nichts von alledem. Nun wusste er es, ja, und was war mit dem großen Geheimnis? Es ist merkwürdig, aber auch dort, in der Toilette, kam ihm nicht in den Sinn, dass da eines war. Und es vergingen noch viele Jahre, bis er begriff.
Post scriptum. Die Fragen kamen langsam, mit der Zeit: Hörte der Vater, nachdem er aus dem Gefängnis in Prag zurückkam, von alledem? Erzählte es ihm seine Frau? Und in der Annahme, dass er davon hörte, was dachte er darüber? Auch heute weiß er es nicht, denn er fragte nie. Jetzt wollen wir mal sehen, wie du das erklärst….
Und vielleicht, so sagte er zu sich selbst nach vielen Jahren, vielleicht muss man die Antwort in einem anderen Geheimnis suchen, einem größeren und viel schwerwiegenderen. In einem Geheimnis, das er nie lösen konnte.
Am Ende der Zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts verließ sein Vater Polen mit einem seiner Brüder. Er kam hierher, nach Palästina. Sein Bruder überquerte den Ozean nach Amerika. In Podhajce, ihrer kleinen Heimatstadt, blieben Eltern, zwei Brüder und eine Schwester. Wenig später wurden sie alle umgebracht.
Sein Vater sprach nie darüber. Kein Wort. Und er, der Dumme, fragte nicht. Es wird schon noch der richtige Moment dazu kommen, sagte er sich. Er wollte es tun, nachdem sie von den zwei Jahren in Hawaii zurückkamen, aber sein Vater wartete nicht. Ein erster Hirnschlag, der zweite wenig später, beendeten sein Leben, während sie noch dort waren, im Herzen des pazifischen Ozeans. Er hatte die Gelegenheit verpasst. Sie würden nie darüber sprechen. Und das große Geheimnis seiner Kindheit, wie winzig war es doch diesem gegenüber? Und all seine Fragen wurden vielleicht von dieser anderen, großen und viel belastenderen versperrt, die nie gestellt wurde….
Nach alledem bleibt das Versäumnis. Das verfluchte und brennende Versäumnis, das ganz das seine ist. Wie, um alles in der Welt, hatte er es zugelassen? Er weiß es einfach nicht (er wüsste es gerne). Denn auch das ist ein Geheimnis, bis heute, und vielleicht das traurigste.

Hat Ihnen dieser Auszug gefallen? Es gibt eine andere Geschichte, die Ihnen gefallen könnte. Sie spielt auch in einem Kibbutz in den 50er Jahren.
Und hier ist ein Link zu unserer Literaturecke. Viel Vergnügen beim Lesen!



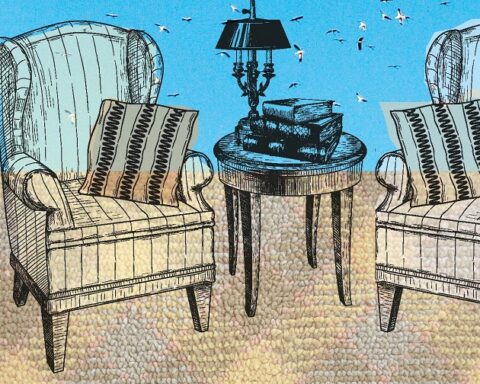






Sehr schön! Irgendwie ist das ein Requiem für die Hitjaschwut HaOwedet – sieht es der Autor oder Übersetzer auch so? Ich frage sicherheitshalber (steht nicht da) ob Mordechai Oren der Vater von Moshe Oren (der eine Webseite hat: mosheoren.com) ist?
Ja, genau. Mordechai Oren ist der Vater von Moshe Oren, und seine website ist http://www.mosheoren.com. Er schrieb die Geschichte in dritter Person, und er wollte seinen ziemlich berühmten Vater (jedenfalls ist er einigen bekannt) in dieser Geschichte so weit wie möglich im Hintergrund lassen. Mordechai Orens Kibbutzbewegung „HaKibbutz HaArtzi“ (des HaSchomer Hatzair) war damals wegen Orens Prozess in Prag gespalten. Viele Mitglieder wurden aus vielen Kibbutzim wegen der Meinungsverscheidenheiten ausgeschlossen, usw…
Merci fuer die Info. Follow-Up-Frage: war die von dir erwaehnte Spaltung der Kibbutzbewegung und Orens Prozess ein „Vorspiel“ zu der Frage, die 1968 (Prager Fruehling) die Kibbutzbewegung noch mehr spaltete: Stalin unterstuetzen oder nicht? Bzw. Was ist der wahre Sozialismus – Sowjetunion unterstuetzen oder unterdrueckte Nationen (wie die Tschechei) unterstuetzen, auch wenn die Unterdruecker Sozialisten sind?
Natuerlich kann man auch fragen, wie sozialistisch die Kibbutzbewegubg wirklich war…
Du bist ein bisschen anachronistisch verwirrt. Der Slanski-Prozess war 1953. Im gleichen Jahr starb Stalin, und in den Kibbutzim des „Kibbutz Ha’artzi“ (Haschomer Hatzair) betrauerte man den Tod des Halbgottes. Aber 1956 kam der 20. Parteitag der KPdSU mit den erschütternden Enthüllungen über Stalins Verbrechen. Danach gab es offiziell keine Anhänger von Stalin mehr im Haschomer Hatzair, und auch die Unterstützung der UdSSR nahm mehr und mehr ab. Den endgültigen Todesstoss erhielt sie mit dem Krieg von 1967, als sich die Fronten eindeutig abzeichneten. 1968 existierte diese Frage also nicht mehr im Haschomer Hatzair/HaKibbutz Ha’artzi/MAPAM, nur noch in der israelischen KP, die ein Kapitel für sich ist.
Es gab übrigens zur selben Zeit (1953), und ein und zwei Jahre davor, eine andere Spaltung in einer anderen Kibbutzbewegung, die viel weitreichendere Folgen hatte und auch mit dem Verhältnis zur UdSSR zu tun hat, nämlich die Spaltung im HaKibbutz HeMeuchad. Einige der Kibbutzim spalteten sich deswegen, und so gibt es heute den Kibbutz Givat-Haim-Ichud und Givat-Haim-Meuchad, und Ashdot Yaakov-Ichud und Ashdot Yaakov-Meuchad usw. Der ideologische Riss ging manchmal mitten durch die Familie, und alles begann, als Achdut HaAwoda sich von MAPAM abspalteten, und alles hier Besprochene hat mit der Frage zu tun, mit welchem der beiden Kontrahenden im Kalten Krieg der junge Staat, der gerade erst gegründet wurde (1948), gehen sollte. Beide, sowohl USA wie UdSSR hatten die Gründung des Staates unterstützt, aber tatsächlich war es die UdSSR, die viel mehr dazu beitrag, dass die israelische Armee im Krieg von 1948 schlussendlich die völlige Übermacht gewann. Ben-Gurion entschied sich trotzdem für die USA, und sein ergebener Generaldirektor des Verteidigungsministeriums begann sofort mit der Entwicklung der israelischen Atomwaffen.
Danke fuer die Antwort! Es gehoert sicherlich zu den grossen „was waere wenn“- Fragen der israelischen Geschichte (wenn Ben-Gurion sich fuer die UdSSR statt fuer die USA entschieden haette), aber wie wir sehen, selbst bei den Kibbutzim war eine Entscheidung nicht 100% eindeutig…
PS zum Tod Stalins und dem Teils sehr skurillem Nachspiel gab es kuerzlich eine britische Kommoedie namens „der Tod Stalins“, sehr empfehlenswet, hier der Trailer: https://m.youtube.com/watch?v=zVvFE8-DTUQ